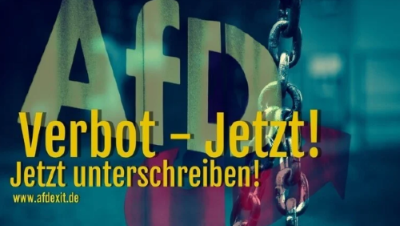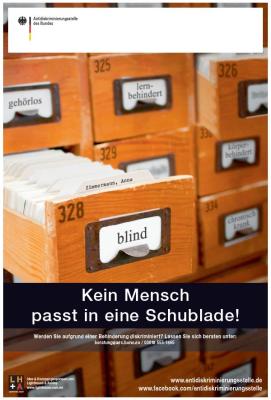Thema: Umwelt
13. September 16 | Autor: antoine favier | 2 Kommentare | Kommentieren
Da beteiligt sich die Stadt Frechen erstmals an der europäischen Woche der Mobilität und unsere Frechener Jamaika-Koalition verbreitet unsäglichen Unsinn.
So erklärt die FDP-Fraktionsvorsitzende S.Kayser-Dobiey, es sei Ziel möglichst viele Pendler, die nach Köln fahren, davon zu überzeugen, auf das Fahrrad umzusteigen. Und für die Grünen ist das Pedelec dafür das Mittel erster Wahl.
Wer nun regelmäßig zwischen Frechen und Köln mit dem Rad pendelt, der hat ein konkretes Ziel: möglichst rasch von A nach B kommen. Pendler*innen erkennt man im Übrigen leicht daran, dass sie ein recht hohes Tempo fahren, nämlich meistens mehr als 20 Stundenkilometer.
Um dieses Ziel zu erreichen, benötigt er einige wenige Dinge, die da wären:
• eine möglichst kreuzungsarme Streckenführung
• einen glatten (asphaltierten) Belag, damit es vernünftig rollt (warum kriegen Autos den Asphalt und Fahrradwege diese blöden Steinplatten?)
• echte Radwege, also keine kombinierten Fuß-/Radwege, denn wer überfährt schon gerne Hunde, Kinder, alte Menschen?
Mit anderen Worten: wir reden über eine vernünftige Infrastruktur. Für diese sind innerörtlich meist die Kommunen zuständig. Die Mängel im Frechener Radwegnetz sind bekannt, auch der Zustand der Radwege ist keine Novität, wer radelt, der weiß, wo die Löcher im Belag sind, wo das Wurzelwerk den Radweg aufbricht und der weiß auch, dass hieran seit Jahren nichts getan wird.
Wer radelt weiß auch, welchen Fuß-/Radweg er meidet, weil zu viele Hundebesitzer*innen mit den schön langen Schnappleinen unterwegs sind, Schüler*innen alles blockieren oder aber Autobesitzer den Weg für kurz- oder langfristiges Parken zweckentfremden.
Alles Dinge die bekannt sind. Man hätte schon lange etwas tun können – es ist aber nichts geschehen und machen wir uns nichts vor – es wird auch nichts Entscheidendes passieren.
Und die grünen Heilsbringer, die Pedelecs? Unter Berufspendler*innen spielen Pedelecs, so eine persönliche Beobachtung, bisher eine untergeordnete Rolle, denn ohne bessere Infrastruktur fahren eh nur die, die es bisher schon getan haben und die radeln seit Jahren ohne Hilfsmotor. Neue Pendler*innen gewinnt man nicht, weil man plötzlich einen Elektromotor am Fahrrad hat. Pedelecs bringen die Rentner*innen wieder auf’s Rad. Das ist schön … für die ältere Generation. Im Berufsverkehr aber spielt das keine Rolle.
Ach ja, bleibt noch die Idee der CDU-Fraktion, während der europäischen Woche der Mobilität im kommenden Jahr die Bachemer Straße zwischen Bonnstraße und Marsdorf für den Verkehr sperren zu lassen. Damit die Menschen sicherer Richtung Köln radeln können. Klingt gut, da es sich aber um eine Kreisstraße handelt, ist davon auszugehen, dass der Kreis darüber mitentscheiden will. Entlang der Straße gibt es einen vernünftigen Radweg, was erwarten lässt, dass der Kreis diesen Vorschlag ablehnen wird. Dann war es aber der "böse" Kreis, der eine "tolle" CDU-Idee ablehnt, wie gemein aber auch.
Es wäre also viel besser, wenn 2017 Straßen in Frechen selber für den Autoverkehr gesperrt würden, deren Sperrung einen echten Sicherheitsgewinn für Radler*innen und Fußgänger bieten würden.
Wie wäre es denn mit eine Sperrung der Toni-Ooms-Straße und des Freiheitsrings? Der Radweg fehlt bzw. ist in einem verheerenden Zustand.
Oder mit der Franzstraße? Auch hier haben wir fehlende Radwege bzw. diese unsägliche Kombination von Rad- und Fußweg.
Diese Sperrungen zugunsten von Radler*innen und Fußgängern erbrächten einen wirklichen Gewinn an Sicherheit und Lebenswert. Aber eine so mutige CDU werden wir nicht erleben, den Grünen hat man den Schneid abgekauft und die SPD-Rentner*innen können sich ein Leben ohne die tägliche Autofahrt in die Frechener Innenstadt vermutlich auch nicht vorstellen.
Denn die einfache Wahrheit lautet: solange der Treibstoff so billig ist, wird niemand auf’s Rad umsteigen. Laut einem Bericht im KStA steigt der Dieselabsatz in Deutschland. Die Gründe sind einfach
1998 forderte die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen, dass der Benzinpreis auf 5 DM je Liter angehoben werden müsse.
Lang, lang ist es her, aber das war der richtige Ansatz.
P.S.: Läddagschwätz kommt aus dem Schwäbischen. Im Netz findet sich ein schwäbisches Wörterbuch.
So erklärt die FDP-Fraktionsvorsitzende S.Kayser-Dobiey, es sei Ziel möglichst viele Pendler, die nach Köln fahren, davon zu überzeugen, auf das Fahrrad umzusteigen. Und für die Grünen ist das Pedelec dafür das Mittel erster Wahl.
Wer nun regelmäßig zwischen Frechen und Köln mit dem Rad pendelt, der hat ein konkretes Ziel: möglichst rasch von A nach B kommen. Pendler*innen erkennt man im Übrigen leicht daran, dass sie ein recht hohes Tempo fahren, nämlich meistens mehr als 20 Stundenkilometer.
Um dieses Ziel zu erreichen, benötigt er einige wenige Dinge, die da wären:
• eine möglichst kreuzungsarme Streckenführung
• einen glatten (asphaltierten) Belag, damit es vernünftig rollt (warum kriegen Autos den Asphalt und Fahrradwege diese blöden Steinplatten?)
• echte Radwege, also keine kombinierten Fuß-/Radwege, denn wer überfährt schon gerne Hunde, Kinder, alte Menschen?
Mit anderen Worten: wir reden über eine vernünftige Infrastruktur. Für diese sind innerörtlich meist die Kommunen zuständig. Die Mängel im Frechener Radwegnetz sind bekannt, auch der Zustand der Radwege ist keine Novität, wer radelt, der weiß, wo die Löcher im Belag sind, wo das Wurzelwerk den Radweg aufbricht und der weiß auch, dass hieran seit Jahren nichts getan wird.
Wer radelt weiß auch, welchen Fuß-/Radweg er meidet, weil zu viele Hundebesitzer*innen mit den schön langen Schnappleinen unterwegs sind, Schüler*innen alles blockieren oder aber Autobesitzer den Weg für kurz- oder langfristiges Parken zweckentfremden.
Alles Dinge die bekannt sind. Man hätte schon lange etwas tun können – es ist aber nichts geschehen und machen wir uns nichts vor – es wird auch nichts Entscheidendes passieren.
Und die grünen Heilsbringer, die Pedelecs? Unter Berufspendler*innen spielen Pedelecs, so eine persönliche Beobachtung, bisher eine untergeordnete Rolle, denn ohne bessere Infrastruktur fahren eh nur die, die es bisher schon getan haben und die radeln seit Jahren ohne Hilfsmotor. Neue Pendler*innen gewinnt man nicht, weil man plötzlich einen Elektromotor am Fahrrad hat. Pedelecs bringen die Rentner*innen wieder auf’s Rad. Das ist schön … für die ältere Generation. Im Berufsverkehr aber spielt das keine Rolle.
Ach ja, bleibt noch die Idee der CDU-Fraktion, während der europäischen Woche der Mobilität im kommenden Jahr die Bachemer Straße zwischen Bonnstraße und Marsdorf für den Verkehr sperren zu lassen. Damit die Menschen sicherer Richtung Köln radeln können. Klingt gut, da es sich aber um eine Kreisstraße handelt, ist davon auszugehen, dass der Kreis darüber mitentscheiden will. Entlang der Straße gibt es einen vernünftigen Radweg, was erwarten lässt, dass der Kreis diesen Vorschlag ablehnen wird. Dann war es aber der "böse" Kreis, der eine "tolle" CDU-Idee ablehnt, wie gemein aber auch.
Es wäre also viel besser, wenn 2017 Straßen in Frechen selber für den Autoverkehr gesperrt würden, deren Sperrung einen echten Sicherheitsgewinn für Radler*innen und Fußgänger bieten würden.
Wie wäre es denn mit eine Sperrung der Toni-Ooms-Straße und des Freiheitsrings? Der Radweg fehlt bzw. ist in einem verheerenden Zustand.
Oder mit der Franzstraße? Auch hier haben wir fehlende Radwege bzw. diese unsägliche Kombination von Rad- und Fußweg.
Diese Sperrungen zugunsten von Radler*innen und Fußgängern erbrächten einen wirklichen Gewinn an Sicherheit und Lebenswert. Aber eine so mutige CDU werden wir nicht erleben, den Grünen hat man den Schneid abgekauft und die SPD-Rentner*innen können sich ein Leben ohne die tägliche Autofahrt in die Frechener Innenstadt vermutlich auch nicht vorstellen.
Denn die einfache Wahrheit lautet: solange der Treibstoff so billig ist, wird niemand auf’s Rad umsteigen. Laut einem Bericht im KStA steigt der Dieselabsatz in Deutschland. Die Gründe sind einfach
Verstärkend kommt hinzu, dass sich Autofahrer 'weniger preissensibel verhalten', so formulierte es kürzlich Aral-Chef Patrick Wendeler. Der billige Sprit ermuntere schlicht dazu, sich häufiger ans Steuer zu setzen. (…) - Kraftstoff ist aktuell mehr als 20 Prozent günstiger als vor drei Jahren. Auto-Professor Ferdinand Dudenhöffer sieht genau darin sogar eine Ursache für eine Verhaltensänderung beim Neuwagenkauf, (…)Immer mehr PS sind gefragt. Er hat Dieselpreise und die Motorleistung der neuzugelassenen Pkw analysiert und kommt zu dem Schluss, dass mit der heftigen Verbilligung des Sprits die durchschnittliche Leistung der privat zugelassenen neuen Personenwagen von 2013 bis 2015 einen merklichen Sprung gemacht hat, nämlich um sechs auf 135 PS.Größere Autos, mehr PS, weniger „preissensibel“. Seit einigen Monaten kommen daher auch Verhaltensweisen wieder auf, die man eigentlich für ausgestorben hielt. Vor der Bäckerei wird der Motor laufen gelassen, wenn – es sind meistens Männer – der Mann seine Frühstücksstulle kauft. Auch die Zigaretten und die Autozeitung am Kiosk kauft man wieder bei laufendem Motor. Nur mal gernau hinschauen, so billig ist der Sprit bereits wieder.
1998 forderte die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen, dass der Benzinpreis auf 5 DM je Liter angehoben werden müsse.
Lang, lang ist es her, aber das war der richtige Ansatz.
P.S.: Läddagschwätz kommt aus dem Schwäbischen. Im Netz findet sich ein schwäbisches Wörterbuch.
Thema: Opposition
12. September 16 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
Langsam geht es ans Eingemachte.
Einen ersten Versuchsballon hat die CDU schon gestartet.
Die CDU fragt bei der Verwaltung an, ob man den Zuschussbedarf für die Bäder durch eine Reduzierung der Öffnungszeiten für den öffentlichen Publikumsverkehr an Vormittagen erreichen könne.
Die Antwort der Verwaltung ist recht eindeutig. Ein erkennbares Einsparpotential ergibt sich hierbei nicht.
Aber alleine die Zielrichtung ist schon recht eindeutig, denn es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten eine Defizit zu verringern.
Erstens, in dem man die Kosten reduziert, so wie es die CDU vorschlägt, man kürzt die Öffnungszeiten und spart so Personal ein.
Zweitens, in dem man die Anzahl der Nutzer*innen erhöht, also dass man die Einnahmen erhöht so wie es der Bäderbetrieb in den vergangenen Jahren erfolgreich getan hat.
Ach ja, und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die vielerorts diskutiert und an einigen Orten schon umgesetzt wurde. Man erhöht die Eintrittspreise.
Wollen wir wetten, dass das die nächste Idee der CDU sein wird?
Die Folgen sind bekannt. Die Gemeinde Stolberg hat 2011 die Preise für die Nutzung des Hallenbades ordentlich erhöht. Daraufhin gingen die Besucherzahlen um rund 14% nach unten.
Es darf also bezweifelt werden, dass der Zuschussbedarf der städtischen Bäder nach einer spürbaren Preiserhöhung deutlich reduziert werden kann. Man bezahlt die steigenden Einnahmen je Ticket mit einem deutlichen Rückgang der Nutzer*innen, im schlechtesten Fall ein Nullsummenspiel, im besten Fall ein kaum spürbarer RÜckgang des Zuschussbedarfs.
Und spätestens dann sind wir vielleicht doch dort, wo ein begeisterter Schwimmer die Stadt Frechen heute schon hinsteuern sieht: bei der Diskussion um die Schließung des Freibads.
Und die CDU wird uns dann erzählen, dass man ja alle anderen Möglichkeiten schon diskutiert habe, die Schließung des Freibades sei „alternativlos“.
Einen ersten Versuchsballon hat die CDU schon gestartet.
Die CDU fragt bei der Verwaltung an, ob man den Zuschussbedarf für die Bäder durch eine Reduzierung der Öffnungszeiten für den öffentlichen Publikumsverkehr an Vormittagen erreichen könne.
Die Antwort der Verwaltung ist recht eindeutig. Ein erkennbares Einsparpotential ergibt sich hierbei nicht.
Aber alleine die Zielrichtung ist schon recht eindeutig, denn es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten eine Defizit zu verringern.
Erstens, in dem man die Kosten reduziert, so wie es die CDU vorschlägt, man kürzt die Öffnungszeiten und spart so Personal ein.
Zweitens, in dem man die Anzahl der Nutzer*innen erhöht, also dass man die Einnahmen erhöht so wie es der Bäderbetrieb in den vergangenen Jahren erfolgreich getan hat.
Ach ja, und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die vielerorts diskutiert und an einigen Orten schon umgesetzt wurde. Man erhöht die Eintrittspreise.
Wollen wir wetten, dass das die nächste Idee der CDU sein wird?
Die Folgen sind bekannt. Die Gemeinde Stolberg hat 2011 die Preise für die Nutzung des Hallenbades ordentlich erhöht. Daraufhin gingen die Besucherzahlen um rund 14% nach unten.
Es darf also bezweifelt werden, dass der Zuschussbedarf der städtischen Bäder nach einer spürbaren Preiserhöhung deutlich reduziert werden kann. Man bezahlt die steigenden Einnahmen je Ticket mit einem deutlichen Rückgang der Nutzer*innen, im schlechtesten Fall ein Nullsummenspiel, im besten Fall ein kaum spürbarer RÜckgang des Zuschussbedarfs.
Und spätestens dann sind wir vielleicht doch dort, wo ein begeisterter Schwimmer die Stadt Frechen heute schon hinsteuern sieht: bei der Diskussion um die Schließung des Freibads.
Und die CDU wird uns dann erzählen, dass man ja alle anderen Möglichkeiten schon diskutiert habe, die Schließung des Freibades sei „alternativlos“.
Thema: Dies und Das
12. September 16 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
a) wer hätte ohne diesen Hinweis gewußt, dass man für ein Weißbier ein entsprechendes Glas benötigt?
Eben drum, danke Aldi.
b.) wer hätte gedacht, dass selbst Dosenbier noch richtig chic daherkommen kann?
Eben drum, danke Aldi.
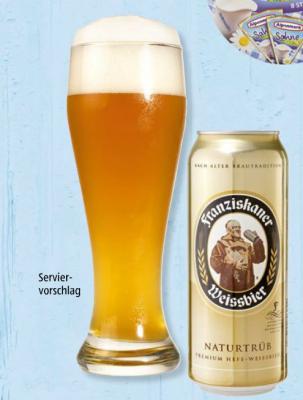
Thema: Zuckungen
07. September 16 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
dann müsste man solchen Unsinn in unserer Qualitätspresse nicht mehr unbedingt lesen:
Nur ein kleines Beispiel: bei der Landtagswahl 2011 haben 157.000 Menschen die CDU gewählt, 2016 nun 154.000. In absoluten Zahlen hat die CDU 2011 und 2016 fast gleich viele Menschen zur Wahl bewegt. Prozentual hat die CDU aber 4% verloren.
Und bei der SPD? 2011 wurde sie von 242.000 Menschen gewählt, 2016 von 246.000. Sie hat sogar 4.000 Stimmen hinzugewonnen. Trotzdem hat sie prozentual 5% verloren.
Das entscheidende Moment wird bei den vereinfachenden Betrachtungen à la Spiegel unterschlagen: die gestiegene Wahlbeteiligung, die sich nur mit dem Auftreten der AfD erklären lässt.
Aus allen Wahlanalysen geht hervor, dass es der AfD gelungen ist, viele in den vergangenen Wahlen abstinente Wähler*innen wieder an die Urnen zu bringen. Möglicherweise hat das Auftreten der AfD auch dazu geführt, dass Menschen, die die AfD verhindern wollen, wieder wählen gegangen sind. Man könnte dann von einem sekundären Mobilisierungseffekt der AfD sprechen: mal wieder wählen gehen, um gegen die AfD zu stimmen.
Wenn es der AfD aber gelingt, mit einem rassistischen und fremdenfeindlichen Wahlkampf, Nichtwähler zu mobilisieren, handelt es sich dann um ein Wählerpotential, um das es sich für demokratische Parteien lohnt, zu kämpfen?
Laut Manfred Güllner spricht alles dafür, dass demokratische Parteien davon die Finger lassen sollten:
Knapp 40% der Wahlberechtigten, die durch Wahlabstinenz ihre Unzufriedenheit mit der Art und Weise zum Ausdruck brachten, wie heute Politik gemacht wird, die aber zugleich in der Wahl der AfD kein angemessenes Ventil für ihre Unzufriedenheit gesehen haben.
Hier ist das Potential, auf das sich die demokratischen Parteien stürzen sollten, wollen sie zu besseren Wahlergebnissen kommen. Für diese Gruppe sollte es sich lohnen, ein attraktives politisches Angebot zu machen. Aber da sind wir wieder beim altbekannten Problem. Man geht wählen, wenn es eine Auswahl gibt. Auswahl bedeutet, dass ein unterscheidbares politisches Angebot vorhanden ist.
Und genau daran mangelt - es auf allen politischen Ebenen.
. Mit Blick auf die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sagte Gabriel dem RBB, die erste Frage sei: Was müssen eigentlich die machen, die massiv an die AfD verloren haben? Das sind nicht Sozialdemokraten. Die CDU hatte die Wahl in Merkels politischer Heimat verloren und war mit 19 Prozent hinter die AfD (20,8 Prozent) zurückgefallen. Was Gabriel jedoch unterschlägt: Auch die SPD von Ministerpräsident Erwin Sellering hatte bei der Wahl am Sonntag fünf Prozentpunkte eingebüßt.Im KStA und in der Frankfurter neuen Presse hat Forsa-Chef Manfred Güllner eine kleine Wahlanalyse platziert, die deutlich macht, dass Wahlanalysen mehr sind als die prozentualen Verlust- und Gewinnbetrachtungen die heutzutage vorherrschen.
Nur ein kleines Beispiel: bei der Landtagswahl 2011 haben 157.000 Menschen die CDU gewählt, 2016 nun 154.000. In absoluten Zahlen hat die CDU 2011 und 2016 fast gleich viele Menschen zur Wahl bewegt. Prozentual hat die CDU aber 4% verloren.
Und bei der SPD? 2011 wurde sie von 242.000 Menschen gewählt, 2016 von 246.000. Sie hat sogar 4.000 Stimmen hinzugewonnen. Trotzdem hat sie prozentual 5% verloren.
Das entscheidende Moment wird bei den vereinfachenden Betrachtungen à la Spiegel unterschlagen: die gestiegene Wahlbeteiligung, die sich nur mit dem Auftreten der AfD erklären lässt.
Aus allen Wahlanalysen geht hervor, dass es der AfD gelungen ist, viele in den vergangenen Wahlen abstinente Wähler*innen wieder an die Urnen zu bringen. Möglicherweise hat das Auftreten der AfD auch dazu geführt, dass Menschen, die die AfD verhindern wollen, wieder wählen gegangen sind. Man könnte dann von einem sekundären Mobilisierungseffekt der AfD sprechen: mal wieder wählen gehen, um gegen die AfD zu stimmen.
Wenn es der AfD aber gelingt, mit einem rassistischen und fremdenfeindlichen Wahlkampf, Nichtwähler zu mobilisieren, handelt es sich dann um ein Wählerpotential, um das es sich für demokratische Parteien lohnt, zu kämpfen?
Laut Manfred Güllner spricht alles dafür, dass demokratische Parteien davon die Finger lassen sollten:
Die schon bei früheren Wahlen zu beobachtende Fehleinschätzung der Verankerung der AfD in der Wählerschaft zeigt sich auch wieder nach dieser Wahl. Die AfD ist nämlich auch nach dem Ergebnis der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern keinesfalls auf dem Weg zu einer Volkspartei, sondern sie erhält nur die Stimmen jener Minorität aller Wahlberechtigten (in Mecklenburg-Vorpommern 12,6 Prozent), die schon immer anfällig waren für fremdenfeindliches, rassistisches und rechtsradikales Gedankengut.Und auch thematisch sitzen wir einer Legende auf, wenn wir den populärpolitischen Erklärungsansätzen auf den Leim gehen: Mitnichten kann gelten,
Dieses latent schon immer vorhandene Potenzial liegt in ganz Deutschland bei 12 bis 15 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern, wo schon 1992 in Rostock-Lichtenhagen der bisher brutalste Anschlag auf ein Flüchtlingsheim stattfand, dürfte es eher höher sein. Die AfD hat also mitnichten – wie für eine Volkspartei charakteristisch – eine heterogene Wählerschaft, sondern eine im Hinblick auf ihre Grundeinstellung sehr homogene.
dass {Frau Merkels] Flüchtlingspolitik angeblich „zum einzigen Wahlkampfthema wurde“ und die Bundespolitik somit die Landespolitik überlagert habe.Aus Meinungsumfragen lässt sich ableiten, dass diese Aussage nur für das AFD-Wählerklientel galt.
Alle anderen Wähler und Nichtwähler jedoch gaben mit großer Mehrheit an, für sie sei bei der Frage, ob man sich an der Wahl beteilige oder nicht, oder welcher Partei man die Stimme gebe, die Landespolitik entscheidender als die Bundespolitik.Der Verweis auf die Wirkungsmächtigkeit der Flüchtlingskrise lenkt nur davon ab, sich mit den eigenen politischen Schwächen zu beschäftigen, findet M.Güllner und er verweist auf die Gruppe der Nichtwähler, die in Mecklenburg-Vorpommern mit 39,5% aller Wahlberechtigten mehr als dreimal so groß war, wie die Gruppe der AfD-Wähler, die es zu beachten gelte.
Knapp 40% der Wahlberechtigten, die durch Wahlabstinenz ihre Unzufriedenheit mit der Art und Weise zum Ausdruck brachten, wie heute Politik gemacht wird, die aber zugleich in der Wahl der AfD kein angemessenes Ventil für ihre Unzufriedenheit gesehen haben.
Hier ist das Potential, auf das sich die demokratischen Parteien stürzen sollten, wollen sie zu besseren Wahlergebnissen kommen. Für diese Gruppe sollte es sich lohnen, ein attraktives politisches Angebot zu machen. Aber da sind wir wieder beim altbekannten Problem. Man geht wählen, wenn es eine Auswahl gibt. Auswahl bedeutet, dass ein unterscheidbares politisches Angebot vorhanden ist.
Und genau daran mangelt - es auf allen politischen Ebenen.
 Gegenentwürfe
Gegenentwürfe