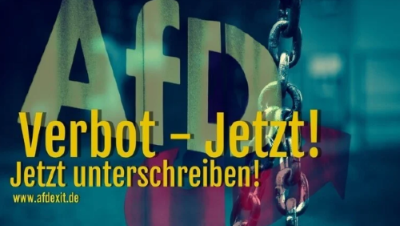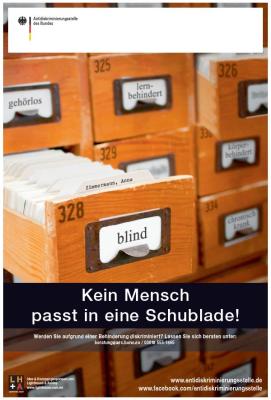Thema: Radschnellweg
25. November 16 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
Heute wurde im KStA unter der Überschrift: Radschnellweg Köln-Frechen kommt im Schneckentempo über den zähen Fortgang der Planungen des Radschnellweges berichtet. Dass hier im Großraum Köln alles länger braucht als anderswo, geschenkt. Das uns ein Baubeginn frühestens in 2018 angekündigt wird, auch geschenkt. Man muss ja nicht alles glauben, was aus der Kölner Stadtverwaltung kommt.
Was aber massiv beunruhigen muss ist die mitgelieferte Planungsskizze:

Die ursprüngliche Planung sah so aus:

Der Unterschied: der Radschnellweg wurde entlang der A1 zur Straßenbahntrasse geführt und sollte dann auf der Eisenbahntrasse die A1 und die B 264 queren und am Bahnhof Frechen enden.
Das neue Bild zeigt einen Radschnellweg, der entlang der Bachemer Straße bis zur Bonner Straße geführt wird und dann abrupt endet.
Sollte hier die in den ursprünglichen Unterlagen als verworfene Alternative 2 angedachte Streckenführung „revitalisiert“ worden sein, so stellt sich die Frage, ob überhaupt noch von einem Radschnellweg Köln-Frechen gesprochen werden kann. Ein Radschnellweg, der einen guten Kilometer abseits jeglicher menschlicher Behausungen auf freiem Feld endet, sieht eher nach einem Schildbürgerstreich aus, denn als eine ernsthafte Planung, um Menschen vom Auto auf’s Fahrrad zu locken.
Was aber massiv beunruhigen muss ist die mitgelieferte Planungsskizze:

Die ursprüngliche Planung sah so aus:

Der Unterschied: der Radschnellweg wurde entlang der A1 zur Straßenbahntrasse geführt und sollte dann auf der Eisenbahntrasse die A1 und die B 264 queren und am Bahnhof Frechen enden.
Das neue Bild zeigt einen Radschnellweg, der entlang der Bachemer Straße bis zur Bonner Straße geführt wird und dann abrupt endet.
Sollte hier die in den ursprünglichen Unterlagen als verworfene Alternative 2 angedachte Streckenführung „revitalisiert“ worden sein, so stellt sich die Frage, ob überhaupt noch von einem Radschnellweg Köln-Frechen gesprochen werden kann. Ein Radschnellweg, der einen guten Kilometer abseits jeglicher menschlicher Behausungen auf freiem Feld endet, sieht eher nach einem Schildbürgerstreich aus, denn als eine ernsthafte Planung, um Menschen vom Auto auf’s Fahrrad zu locken.
Thema: Aus fremden Federn
18. November 16 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
Wer heute über den Rechtspopulismus Gedanken macht, der sollte den Blick auch nach Frankreich wenden.
Die französische Gesellschaft hat mit dem Front National langjährige Erfahrungen mit einer rechtspopulistische Partei. Vieles, was uns mit dem Aufkommen der AFD als neu erscheint, kennt Frankreich schon seit Jahren.
Selbst der Wahlerfolg eines Donald Trump lässt sich einfacher erklären, wenn man die französische Entwicklung als europäischen Erfahrungshorizont mitdenkt.
Der französische Soziologe Didier Eribond hat 2009 eine autobiographische Annäherung an seine eigene Kindheit in Reims geschrieben. Er, der in Reims als Kind einer Arbeiterfamilie großgeworden ist, reflektiert dabei nicht nur seinen Aufstieg aus diesem proletarischen Milieu in die Welt der Pariser Intellektuellen.
Er beschreibt auch, wie dieses proletarische Milieu an seinen eigenen politischen Vertretern irre wurde und sich dem Front National zugewandt hat.
Hier werden zwei längere Passagen zitiert, die erklären, wie der Rechtspopulismus, diese bürgerliche Formation der rassistischen Rechten, auch zur Partei der Arbeiter werden konnte.
Zugleich ist dies damit auch eine Leseempfehlung, da dieses Buch seit diesem Jahr auch in deutscher Sprache vorliegt:
Didier Eribond
Eine Reise nach Reims,
Suhrkamp, Berlin 2016
Die französische Gesellschaft hat mit dem Front National langjährige Erfahrungen mit einer rechtspopulistische Partei. Vieles, was uns mit dem Aufkommen der AFD als neu erscheint, kennt Frankreich schon seit Jahren.
Selbst der Wahlerfolg eines Donald Trump lässt sich einfacher erklären, wenn man die französische Entwicklung als europäischen Erfahrungshorizont mitdenkt.
Der französische Soziologe Didier Eribond hat 2009 eine autobiographische Annäherung an seine eigene Kindheit in Reims geschrieben. Er, der in Reims als Kind einer Arbeiterfamilie großgeworden ist, reflektiert dabei nicht nur seinen Aufstieg aus diesem proletarischen Milieu in die Welt der Pariser Intellektuellen.
Er beschreibt auch, wie dieses proletarische Milieu an seinen eigenen politischen Vertretern irre wurde und sich dem Front National zugewandt hat.
Hier werden zwei längere Passagen zitiert, die erklären, wie der Rechtspopulismus, diese bürgerliche Formation der rassistischen Rechten, auch zur Partei der Arbeiter werden konnte.
Zugleich ist dies damit auch eine Leseempfehlung, da dieses Buch seit diesem Jahr auch in deutscher Sprache vorliegt:
Didier Eribond
Eine Reise nach Reims,
Suhrkamp, Berlin 2016
Wenn ich meine Mutter heute vor mir sehe mit ihrem geschundenen, schmerzenden Körper, der fünfzehn Jahre lang unter härtesten Bedingungen gearbeitet hat – am Fließband stehen, Deckel auf Einmachgläser schrauben, sich morgens und nachmittags höchstens zehn Minuten von jemandem vertreten lassen, um auf die Toilette gehen zu können -, dann überwältigt mich die konkrete physische Bedeutung des Wortes „soziale Ungleichheit“. Das Wort „Ungleichheit“ ist eigentlich ein Euphemismus, in Wahrheit haben wir es mit nackter, ausbeuterischer Gewalt zu tun.(S. 78 / 79)
Der Körper einer alternden Arbeiterin führt allen die Wahrheit über die Klassengesellschaft vor Augen. Man kann sich kaum vorstellen, wie hart der Arbeitsrhythmus in diesem Werk (und in allen anderen Fabriken) war. Ein Vorarbeiter hatte eines Tages ein paar Minuten die Leistung einer Arbeiterin gemessen und so die Mindestzahl der Gläser bestimmt, die es „zu machen“ galt. Schon das klingt extrem, ja inhuman. Doch weil ein Großteil des Lohns aus Prämien bestand, brachten meine Mutter und ihre Kollegen es fertig, das Doppelte der geforderten Menge zu produzieren. Abends kam sie ausgelaugt nach Hause, „ausgewrungen“, wie sie selber sagte, aber froh, wieder einen Tag hinter sich gebracht und genug verdient zu haben, um uns ein anständiges Leben zu ermöglichen. Es ist mir völlig unbegreiflich, wie die extreme Härte solcher Arbeitsformen und der Protest gegen sie („Nieder mit dem höllischen Akkord!“) aus den Vorstellungen der Linken verschwinden konnten, obwohl gerade hier die konkrete Existenz der Menschen – ihre Gesundheit zum Beispiel – auf dem Spiel steht.
Man fühlte sich von den Gewählten vernachlässigt oder gar verraten. „Die Politiker sind alle gleich. Ob links oder rechts, die Rechnung zahlen immer dieselben“ – solche Sätze begann man damals zu hören (…). Die sozialistische Linke unterzog sich einer radikalen, von Jahr zu Jahr deutlicher werdenden Verwandlung und ließ sich mit fragwürdiger Begeisterung auf neokonservative Intellektuelle ein, die sich unter dem Vorwand der geistigen Erneuerung daran machten, den Wesenskern der Linken zu entleeren. Es kam zu einer regelrechten Metamorphose des Ethos und der intellektuellen Koordinaten. Nicht mehr von Ausbeutung und Widerstand war die Rede, sondern von „notwendiger Reformen“ und einer „Umgestaltung“ der Gesellschaft. Nicht mehr von „Klassenverhältnissen oder sozialem Schicksal, sondern von „Zusammenleben“ und „Eigenverantwortung“. Die Idee der Unterdrückung, einer strukturierenden Polarität zwischen Herrschenden und Beherrschten, verschwand aus dem Diskurs der offiziellen Linken und wurde durch die neutralisierende Vorstellung des „Gesellschaftsvertrags“ ersetzt, in dessen Rahmen „gleichberechtigte“ Individuen (gleich? Was für ein obszöner Witz) auf die Artikulation von Partikularinteressen zu verzichten (das heißt zu schweigen und sich von den Regierenden nach deren Gusto regieren zu lassen) hätten. Welche ideologischen Ziele verfolgte diese diffuse „politische Philosophie“, die links wie rechts, an beiden Enden des medialen und politischen Spektrums, gefeiert wurde? (Praktischerweise erklärten ihre Verfechter die Grenzen zwischen rechts und links für aufgehoben und drängten so die Linke, mit deren Einverständnis, nach rechts.) Die Absichten wurden kaum verschleiert: Das Beschwören des „autonomen Subjekts“ und die damit einhergehende Verabschiedung aller Überlegungen, die von der determinierenden Kraft historischer und sozialer Gegebenheiten ausgehen, zielten darauf, die Idee, es gäbe so etwas wie soziale Gruppen („Klassen“), ein für alle Mal zu entsorgen. Im Namen einer vermeintlich notwendigen „Individualisierung“ (oder Entkollektivierung, Entsozialisierung), die das Arbeitsrecht, die sozialen Sicherungssysteme und allgemeiner die Mechanismen der gesellschaftlichen Solidarität und Umverteilung betraf, wurde im gleichen Zug der Rückbau des Wohlfahrtsstaats legitimiert. Ein Gutteil der Linken schrieb sich nun plötzlich das alte Projekt des Sozialabbaus auf die Fahnen, das zuvor ausschließlich von rechten Parteien vertreten und zwanghaft wiederholt worden war (…). Man könnte es auch so zusammenfassen: Die linken Parteien mit ihren Partei- und Staatsintellektuellen dachten und sprachen fortan nicht mehr die Sprache der Regierten, sondern jene der Regierenden, sie sprachen nicht mehr im Namen von und gemeinsam mit den Regierten, sondern mit und für die Regierenden, sie nahmen gegenüber der Welt nunmehr einen Regierungsstandpunkt ein und wiesen den Standpunkt der Regierten verächtlich von sich, und zwar mit einer verbalen Gewalt, die von den Betroffenen durchaus als solche erkannt wurde.(S. 122-125)
(…) Wenn man „Klassen“ und Klassenverhältnisse einfach aus den Kategorien des Denkens und Begreifens und damit aus dem politischen Diskurs entfernt, verhindert man aber noch lange nicht, dass sich all jene kollektiv im Stich gelassen fühlen, die mit den Verhältnissen hinter diesen Wörtern objektiv zu tun haben. Von den Verfechtern des „Zusammenhalts“, der „notwendigen“ Deregulierung und des „notwendigen“ Rückbaus sozialer Sicherungssysteme fühlten sie sich nicht länger repräsentiert. Das war der Grund, weshalb sich im Rahmen einer wie von selbst ablaufenden Neuverteilung der politischen Karten große Teile der Unterprivilegierten jener Partei zuwandten, die sich nunmehr als einzige um sie zu kümmern schien und die zumindest einen Diskurs anbot, der versuchte, ihrer Lebensrealität wieder einen Sinn zu verleihen.
(…) Mit der Wahl der Kommunisten versicherte man sich stolz seiner Klassenidentität, man stellte diese Klassenidentität durch die politische Unterstützungsgeste für die „Arbeiterpartei“ gewissermaßen erst richtig her. Mit der Wahl des Front National verteidigte man hingegen still und leise, was von dieser Identität noch geblieben war und welche die Machtpolitiker und institutionellen Linken (…) ignorierten oder sogar verachteten.
(…) So widersprüchlich es klingen mag ich bin mir doch sicher, dass man die Zustimmung zum Front National zumindest teilweise als eine Art Notwehr der unteren Schichten interpretieren muss. Sie versuchten, ihre kollektive Identität zu verteidigen oder jedenfalls eine Würde, die seit je mit Füßen getreten worden ist und nun sogar von denen missachtet wurde, die sie zuvor repräsentiert und verteidigt hatten. Würde, dieses zerbrechliche und sich selbst nicht sichere Gefühl. Sie verlangt nach Gesten der Bestätigung. Entwürdigt fühlen sich die Menschen vor allem dann, wenn sie sich als quantité négligeable, als bloßes Element politischer Buchführung und damit als ein stummer Gegenstand politischer Verfügungen vorkommen. Wenn die, denen man sein Vertrauen einmal gegeben hat, dieses nicht mehr verdienen, überträgt man es eben anderen. Man wendet sich, und sei es temporär oder in punktuellen Fragen, neuen Repräsentanten zu. Wessen Fehler ist es also, wenn die scheinbar letzte politische Rettung ein solches Gesicht trägt? Wenn die überlebende oder wiederhergestellte Bedeutung des „Wir“ sich dermaßen gewandelt hat, dass sich nun nicht länger die „Arbeiter“ den „Bourgeois“ gegenüberstehen, sondern die „Franzosen“ den „Ausländern“? Oder genauer: Wenn der Gegensatz zwischen „uns hier unten“ und „denen da oben“ in den sich der zwischen Arbeitern und Bourgeois verwandelt hat (was schon nicht mehr dasselbe ist und jeweils unterschiedliche politische Schlussfolgerungen impliziert), plötzlich eine nationale und ethnische Komponente bekommt, weil „die da oben“ als Befürworter einer Immigration wahrgenommen werden, deren Folgen „die da unten“ angeblich jeden Tag zu ertragen haben, eine Einwanderung, die plötzlich für alle möglichen Übel verantwortlich gemacht wird?
Thema: Grüne
15. November 16 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
Jetzt hat die Frechener SPD unsere Grünen etwas erschreckt.
Denn die SPD hat, im Zusammenhang mit den angedrohten Fällungen der Kugelahorne in der Fußgängerzone, die alte grüne Forderung nach der Wiedereinführung einer Baumschutzsatzung aufgegriffen.
Das darf die SPD ja eingetlich nicht. Das kommt nämlich einer Majestätsbeleidigung gleich. Ein urgrünes Thema, das die Grünen schon seit Jahren beschäftigt, wird von der SPD erneut in die politische Diskussion geworfen. Und dann auch noch zu Unzeiten.
Das kann man der SPD als Grüne natürlich nicht so einfach durch gehen lassen.
Also gibt es eine hübsche Pressemitteilung, in der die Grünen ihr Copyright auf das Thema betonen und darauf hinweisen, dass die Baumschutzsatzung ja von den Grünen im Koalitionsvertrag verankert worden sei.
Baumschutz nur für Bäume, die nicht auf privaten Grundstücken stehen. Womit die meisten zu schützenden Bäume im Stadtgebiet außerhalb des Regelungsbereichs der Satzung verbleiben würden.
Das wäre irgendwie, sagen wir mal, unverfänglich bis unverständlich für alle Bürge*rinnen, ja, ja wenn nicht die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage die Intention einer Baumschutzsatzung in einem einfachen Satz klar formuliert hätte:
Die SPD hat diese Forderung aufgegriffen.
Die Grünen fühlen sich in ihrer Kernkompetenz angegriffen, sind aber durch den Koalitionsvertrag gebunden, der ja gerade den Umgang mit dem privaten Baumbestand nicht mit einer Baumschutzsatzung regulieren will.
Was also nun?
und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Und genau das wird nun von Jamaika initiiert.
Man plant eine Anhörung und man streut Nebelbomben.
Die Grünen erzählen nun von aktueller Rechtsprechung, von neuen Entwicklungen die zu berücksichtigen seien. Man erfindet neue Problemlagen, wie den Zusammenhang von Baumschutz und Solaranlagen, oder das „Thema Allergien bei Bewohnern in der Nähe von Bäumen“ und man will nun über eine „Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung“ bei Neubaugebieten reden.
Das klingt alles hoch wichtig und hochprofessionell und soll doch nur davon ablenken, dass die SPD die Grünen komplett auf dem falschen Fuß erwischt hat.
Die Grünen haben, als sie diesen Koalitionsvertrag unterschrieben haben, ihren alten Programmpunkt „Baumschutzsatzung“ einfach aufgegeben, ja verraten.
Dumm nur, wenn es nun droht offenkundig zu werden, da macht man Verbiegungen und Verrenkungen, dass es eine wahre Freude für alle informierten Zuschauer*innen ist.
Denn die SPD hat, im Zusammenhang mit den angedrohten Fällungen der Kugelahorne in der Fußgängerzone, die alte grüne Forderung nach der Wiedereinführung einer Baumschutzsatzung aufgegriffen.
Das darf die SPD ja eingetlich nicht. Das kommt nämlich einer Majestätsbeleidigung gleich. Ein urgrünes Thema, das die Grünen schon seit Jahren beschäftigt, wird von der SPD erneut in die politische Diskussion geworfen. Und dann auch noch zu Unzeiten.
Das kann man der SPD als Grüne natürlich nicht so einfach durch gehen lassen.
Also gibt es eine hübsche Pressemitteilung, in der die Grünen ihr Copyright auf das Thema betonen und darauf hinweisen, dass die Baumschutzsatzung ja von den Grünen im Koalitionsvertrag verankert worden sei.
Im Koalitionsvertrag der Koalition aus CDU, Grüne und FDP in Frechen ist die Wiedereinführung einer Baumschutzsatzung in Frechen auf Wunsch der Grünen vereinbart worden; „nun geht es an die konkrete Umsetzung im Rat“ so Miriam Erbacher, Fraktionsvorsitzende der grünen Ratsfraktion.Die Grünen hätten aber besser dazu geschrieben, dass bitte nicht im Koalitionsvertrag nachliest, was sich Jamaika hier auf die Fahnen geschrieben hat:
Die Koalitionsparteien erkennen die Notwendigkeit der Erhaltung der Bäume für den Klimaschutz an und werden die Einführung einer der Baumschutzsatzung vergleichbaren Regelung beschließen, von der privat genutzte Grundstücke ausgenommen sind.Mit anderen Worten:
Baumschutz nur für Bäume, die nicht auf privaten Grundstücken stehen. Womit die meisten zu schützenden Bäume im Stadtgebiet außerhalb des Regelungsbereichs der Satzung verbleiben würden.
Das wäre irgendwie, sagen wir mal, unverfänglich bis unverständlich für alle Bürge*rinnen, ja, ja wenn nicht die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage die Intention einer Baumschutzsatzung in einem einfachen Satz klar formuliert hätte:
Über eine Baumschutzsatzung soll in der Regel vornehmlich der Umgang mit dem privaten Baumbestand geregelt werden.Also: mit einer Baumschutzsatzung soll der Umgang mit dem privaten Baumbestand geregelt werden.
Die SPD hat diese Forderung aufgegriffen.
Die Grünen fühlen sich in ihrer Kernkompetenz angegriffen, sind aber durch den Koalitionsvertrag gebunden, der ja gerade den Umgang mit dem privaten Baumbestand nicht mit einer Baumschutzsatzung regulieren will.
Was also nun?
und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Und genau das wird nun von Jamaika initiiert.
Man plant eine Anhörung und man streut Nebelbomben.
Die Grünen erzählen nun von aktueller Rechtsprechung, von neuen Entwicklungen die zu berücksichtigen seien. Man erfindet neue Problemlagen, wie den Zusammenhang von Baumschutz und Solaranlagen, oder das „Thema Allergien bei Bewohnern in der Nähe von Bäumen“ und man will nun über eine „Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung“ bei Neubaugebieten reden.
Das klingt alles hoch wichtig und hochprofessionell und soll doch nur davon ablenken, dass die SPD die Grünen komplett auf dem falschen Fuß erwischt hat.
Die Grünen haben, als sie diesen Koalitionsvertrag unterschrieben haben, ihren alten Programmpunkt „Baumschutzsatzung“ einfach aufgegeben, ja verraten.
Dumm nur, wenn es nun droht offenkundig zu werden, da macht man Verbiegungen und Verrenkungen, dass es eine wahre Freude für alle informierten Zuschauer*innen ist.
 Gegenentwürfe
Gegenentwürfe