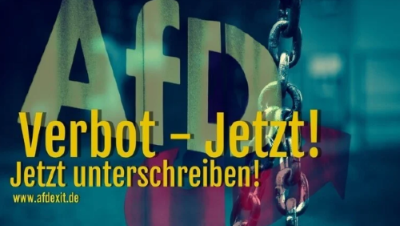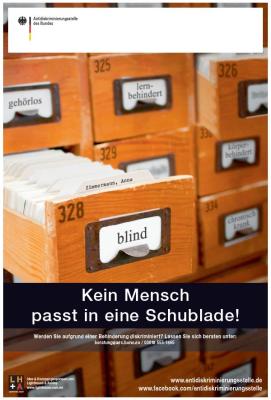Thema: Grüne
06. April 16 | Autor: antoine favier | 4 Kommentare | Kommentieren
Auch wenn man es derzeit kaum glauben mag, aber grundsätzlich ist die grüne Partei auf dem absteigenden Ast. Richtig, auf dem absteigenden. Das mag sich jetzt komisch lesen, haben die Grünen in Baden-Württemberg erst den größten Erfolg ihrer Parteigeschichte errungen. Aber gerade dieser Wahlsonntag im März zeigt auch die andere, die pessimistische Version.
Wir beobachten, vereinfacht gesagt, eine inhaltliche Auszehrung und eine immer stärkere Orientierung hin zum Altbürgertum:
Nun sollte man sich aber nicht allzu sehr mit der grünen Sonderkonjunktur in Baden-Württemberg befassen, denn der dortige Erfolg ist einer landespolitischen Situation geschuldet, die sich so schnell andernorts nicht wiederholen wird. Dank eines zum gütigen Landesvater ummodellierten konservativen Grünen Kretschmann, einer unfähigen CDU und einer in mittiger Beliebigkeit versunkenen SPD, konnten die Grünen in Baden-Württemberg an den Fukushima-Effekt angeknüpft und zur stärksten Partei im Ländle werden. Aber: der Erfolg der Kretsche-Grünen, der zum Lobgesang auf einen grünen Pragmatismus umgedeutet wurde, und in dessen Windschatten eiligst sogenannte linke Positionen ungehindert geräumt wurden, wird langfristig zu massiven Glaubwürdigkeitsdefiziten führen.
Um das zu verstehen, ist es notwendig, den gegenläufigen Trend der grünen Wahlgeschichte in Rheinland-Pfalz zur Kenntnis zu nehmen. Vor fünf Jahren, im Gefolge der Fukushima-Katastrophe waren die Grünen in Rheinland-Pfalz auf 15 % angewachsen. Hier zeigt sich, was passiert, wenn die grüne Glaubwürdigkeit leidet. Die Grünen verloren, bei einer gestiegenen Wahlbeteiligung, über 10% ihrer Stimmen. In der Wählerwanderungsmodell von infratest dimap gehen den Grünen 142.000 Stimmen verlustigt, davon 90.000 an die SPD und 12.000 an die Nichtwähler.
So haben die Grünen Kandidaten in ihrer übergroßen Mehrheit einen Personenbonus, d.h. die Wahlkreiskandidaten haben mehr Stimmen erhalten, als die grüne Landesliste. Das überrascht etwas, denn Grünwähler orientieren sich in ihrer Selbsteinschätzung zu 65% an Sachlösungen und halten Soziale Gerechtigkeit und Umwelt- und Energiefragen für die wichtigsten Themen im grünen Wahlkampf.
Sowohl der Personenbonus als auch die Verluste von rund 10% wollen da nicht recht dazu passen.
Man könnte auch sagen, dass der durchschnittliche Grünenwähler seinen politischen Repräsentanten noch ein ausreichendes Vertrauen entgegenbringt - der Partei hingegen traut er schon deutlich weniger zu.
Im Gegenzug stellt sich dann natürlich die Frage, was rund 90.000 Grünwähler dazu bewegt hat, für die Malu Dreyer und die SPD zu stimmen. Es ist sicherlich nicht zu weit hergeholt, festzustellen, dass die SPD mit Malu Dreyer über eine Spitzenkandidatin verfügte, die das Thema soziale Gerechtigkeit gut besetzt hat. Zusätzlich aber ist den Grünen etwas passiert, was mit einem Fußballzitat am Schönsten beschrieben wird: „Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen die Deutschen.“. Im übertragenen Sinne kennt die SPD diese Situation aus der großen Koalition: Am Ende gewinnt immer Merkel.
In Rheinland-Pfalz ist es den Grünen mit Malu Dreyer so gegangen.
Herr Müntefering fand, dass Opposition Mist sei, aber für Parteien, die sich als Programmparteien verstehen und sich über ihre Lösungskompetenz in Sachfragen definieren, bedeutet Mitregieren oft genug das Ertragen von Kompromissen die mit der eigenen Programmatik nicht immer gut verträglich sind. Und die erstaunte Anhängerschaft stellt dann und wann fest, dass die eigenen Repräsentanten ein je eigenes Verständnis haben, wie ein politisches Programm zu verstehen sei.
Auch dieses Phänomen ist der SPD wohlbekannt. Der Journalist Jürgen Leinemann schrieb über deren Kanzler Gerhard Schröder:
Kretschmann als Landesvater hat im Bundesrat Kompromissen in der Asylpolitik zugestimmt, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären und die mit der grünen Programmatik, so sie noch gelten sollte, von vielen als unvereinbar empfunden wird. Was ein Kretschmann im Großen macht, das geschieht auch auf der Ebene der Landespolitik. In Rheinland-Pfalz etwa beim Thema der Moselbrücke, die die oppositionellen Grünen bekämpften, um ihr als Regierungspartei ihre Zustimmung zu geben.
Man kann also vereinfacht festhalten, dass das Mitregieren für die Grünen in Rheinland-Pfalz unter zweifacher Hinsicht unerfreulich war: Das Mitregieren führte einerseits zu einem allgemeinen Glaubwürdigkeitsverlust und andererseits verkörperte Manu Dreyer einen Politikentwurf, der „grünkompatibel“ ist. Grüne Wählerinnen und Wähler konnten ohne Gesichtsverlust auch für Malu Dreyer stimmen.
Die, ich nenne es mal Malu-Dreyer-Option stellt sich für die SPD, je länger je mehr auch in anderen Bundesländern bzw. auf Bundesebene, denn je länger ein Winfried Kretschmann über zentrale Inhalte der grünen Politik mitentscheiden wird, desto deutlicher wird die Abkehr von den bisherigen programmatischen Inhalten werden. Wobei hier kein Missverständnis aufkommen soll: W.Kretschmann dient hier nur als ein Beispiel. Die Abkehr der grünen Partei von früher sakrosankten Inhalten findet auf allen politischen Ebenen statt. Die Partei wandelt sich, sie hat ihren Frieden mit dieser Republik gemacht. Das Wählerklientel altert ebenso sichtbar wie ihre Frontmänner und –frauen. Die Partei wird konservativer, wird beliebiger.
Um den absteigenden Ast noch etwas näher zu beschreiben, wenden wir uns dem hiesigen Bundesland zu:
Hier in NRW haben wir die spannende Situation, dass die Grünen im Lande mit der SPD koalieren, dass aber auf lokaler Ebene sich der ehemals linke Landesverband immer stärker für die CDU öffnet. Das wird, so kann vermutet werden, und die Kölner Grünen haben es vorgemacht, dazu führen, dass die Grünen ohne klare Koalitionsaussage in den Landtagswahlkampf gehen werden.
Für die SPD ist dies ein Risiko und eine Chance zugleich. Es wird zum Risiko, wenn die SPD in ihren alten politischen Bahnen verharrt und sich bspw. auf eine perspektivlose Verteidigung der rheinischen Braunkohleindustrie versteifen würde, wenn sie weiterhin als Vertreterin der hiesigen Großindustrie (Chemie, Eisen+Stahl Energie) wahr genommen wird, wenn sie sich zur Geisel der Energiemonopolisten machen lassen würde. Das mag den 63jährigen sozialdemokratischen Rentner in Essen oder Dortmund beruhigen, der mit dieser SPD groß und alt geworden ist, aber neue, andere, ökologisch orientierte Wählerschichten sind damit nicht zu gewinnen. Im Verhältnis zur Grünen Partei wird sich in diesem Falle nur wenig ändern. Die SPD ist in diesem Fall zwingend auf einen Koalitionspartner wie die Grünen angewiesen, der den modernisierungswilligen, den ökologischen Teil der Wählerschaft einfängt. Denn als wirtschaftlich strukturkonservative Partei wird sie diese Wählerinnen und Wähler nur schwer für sich gewinnen können.
Aber, in jeder Krise steckt auch eine Chance, insbesondere dann, wenn gute und möglicherweise wegweisende Vorschläge und Ideen von den eigenen Leuten produziert werden.
Erhard Eppler etwa erklärte in dem oben genannten Interview
Das war einmal, das ist nicht mehr.
Oder anders formuliert: die Grünen räumen politische Positionen. Damit lassen sie Wählerinnen und Wähler heimatlos zurück. Hieraus kann man eine Chance herauslesen: wenn die SPD mit einem alternativen Gesellschaftsmodell zum Marktradikalismus, einem Modell, in dem das Ökologische mit dem Sozialen verknüpft wird, antreten würde und wenn hierfür eine Politikerin zur Verfügung steht, die eine solche Neuorientierung glaubwürdig verkörpert, dann bekommen die Grünen ein Problem, denn Teile ihrer Wählerschaft sind aufgrund des Rechtsdralls von einer so erneuerten SPD ansprechbar. Spätstens in diesem Moment erweist sich dann die Öffnung der GRÜNEN hin zur CDU als ein Bumerang, denn mit einer derart positionierten SPD steht den grünen Wählerinnen und Wählern erstmalig seit vielen Jahren wieder eine Alternative zur Verfügung.
Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz hat gezeigt, dass dieser Weg für die SPD erfolgreich begangen werden kann. Man muss ihn nur gehen.
Wir beobachten, vereinfacht gesagt, eine inhaltliche Auszehrung und eine immer stärkere Orientierung hin zum Altbürgertum:
Die Grünen orientieren auf das moderne wohlhabende Bürgertum, jenes postmaterialistische Milieu der sogenannten Lohas (Lifestyle Of Health And Sustainability), die „ökologisch“ und „nachhaltig“ konsumieren, weil sie es sich leisten können – und nur dann Verständnis für diejenigen übrig haben, denen dies nicht möglich ist, wenn es sie nichts kostet. Weswegen ihnen auch eine Koalition mit der Union, die Versöhnung des Neu- mit dem Altbürgertum, näher liegt als Rot-Rot-Grün.In Baden-Württemberg lautet eine Titelzeile zur grünen Programmatik denn auch folgerichtig: Positionen preiswert abzugeben.
Nun sollte man sich aber nicht allzu sehr mit der grünen Sonderkonjunktur in Baden-Württemberg befassen, denn der dortige Erfolg ist einer landespolitischen Situation geschuldet, die sich so schnell andernorts nicht wiederholen wird. Dank eines zum gütigen Landesvater ummodellierten konservativen Grünen Kretschmann, einer unfähigen CDU und einer in mittiger Beliebigkeit versunkenen SPD, konnten die Grünen in Baden-Württemberg an den Fukushima-Effekt angeknüpft und zur stärksten Partei im Ländle werden. Aber: der Erfolg der Kretsche-Grünen, der zum Lobgesang auf einen grünen Pragmatismus umgedeutet wurde, und in dessen Windschatten eiligst sogenannte linke Positionen ungehindert geräumt wurden, wird langfristig zu massiven Glaubwürdigkeitsdefiziten führen.
Um das zu verstehen, ist es notwendig, den gegenläufigen Trend der grünen Wahlgeschichte in Rheinland-Pfalz zur Kenntnis zu nehmen. Vor fünf Jahren, im Gefolge der Fukushima-Katastrophe waren die Grünen in Rheinland-Pfalz auf 15 % angewachsen. Hier zeigt sich, was passiert, wenn die grüne Glaubwürdigkeit leidet. Die Grünen verloren, bei einer gestiegenen Wahlbeteiligung, über 10% ihrer Stimmen. In der Wählerwanderungsmodell von infratest dimap gehen den Grünen 142.000 Stimmen verlustigt, davon 90.000 an die SPD und 12.000 an die Nichtwähler.
„Die Verluste der Grünen betreffen alle Bevölkerungsgruppen, besonders aber traditionell den Grünen zugewandte Wähler: höher Gebildete, Angestellte sowie konfessionslose Wähler.“Es lohnt aber ein tieferer Blick, denn die Probleme der Grünen liegen auf verschiedenen Ebenen.
So haben die Grünen Kandidaten in ihrer übergroßen Mehrheit einen Personenbonus, d.h. die Wahlkreiskandidaten haben mehr Stimmen erhalten, als die grüne Landesliste. Das überrascht etwas, denn Grünwähler orientieren sich in ihrer Selbsteinschätzung zu 65% an Sachlösungen und halten Soziale Gerechtigkeit und Umwelt- und Energiefragen für die wichtigsten Themen im grünen Wahlkampf.
Sowohl der Personenbonus als auch die Verluste von rund 10% wollen da nicht recht dazu passen.
Man könnte auch sagen, dass der durchschnittliche Grünenwähler seinen politischen Repräsentanten noch ein ausreichendes Vertrauen entgegenbringt - der Partei hingegen traut er schon deutlich weniger zu.
Im Gegenzug stellt sich dann natürlich die Frage, was rund 90.000 Grünwähler dazu bewegt hat, für die Malu Dreyer und die SPD zu stimmen. Es ist sicherlich nicht zu weit hergeholt, festzustellen, dass die SPD mit Malu Dreyer über eine Spitzenkandidatin verfügte, die das Thema soziale Gerechtigkeit gut besetzt hat. Zusätzlich aber ist den Grünen etwas passiert, was mit einem Fußballzitat am Schönsten beschrieben wird: „Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen die Deutschen.“. Im übertragenen Sinne kennt die SPD diese Situation aus der großen Koalition: Am Ende gewinnt immer Merkel.
In Rheinland-Pfalz ist es den Grünen mit Malu Dreyer so gegangen.
Herr Müntefering fand, dass Opposition Mist sei, aber für Parteien, die sich als Programmparteien verstehen und sich über ihre Lösungskompetenz in Sachfragen definieren, bedeutet Mitregieren oft genug das Ertragen von Kompromissen die mit der eigenen Programmatik nicht immer gut verträglich sind. Und die erstaunte Anhängerschaft stellt dann und wann fest, dass die eigenen Repräsentanten ein je eigenes Verständnis haben, wie ein politisches Programm zu verstehen sei.
Auch dieses Phänomen ist der SPD wohlbekannt. Der Journalist Jürgen Leinemann schrieb über deren Kanzler Gerhard Schröder:
Keine Werteskala, keine Prioritäten-Hierarchie, kein inneres Geländer und kein äußeres. Nur Ehrgeiz. Und Chuzpe.“Und in einem kürzlich veröffentlichten Interview erklärte Erhard Eppler über Oskar Lafontaine und das Berliner Programm von 1989:
„Lafontaine war Vorsitzender der Programmkommission. (…) Ihm war das Programm völlig gleichgültig. (…) Und später hat er dafür gesorgt, dass dieses Programm praktisch geheim gehalten wurde.“Auch den Grünen bleibt diese Erfahrung nicht erspart.
Kretschmann als Landesvater hat im Bundesrat Kompromissen in der Asylpolitik zugestimmt, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären und die mit der grünen Programmatik, so sie noch gelten sollte, von vielen als unvereinbar empfunden wird. Was ein Kretschmann im Großen macht, das geschieht auch auf der Ebene der Landespolitik. In Rheinland-Pfalz etwa beim Thema der Moselbrücke, die die oppositionellen Grünen bekämpften, um ihr als Regierungspartei ihre Zustimmung zu geben.
Man kann also vereinfacht festhalten, dass das Mitregieren für die Grünen in Rheinland-Pfalz unter zweifacher Hinsicht unerfreulich war: Das Mitregieren führte einerseits zu einem allgemeinen Glaubwürdigkeitsverlust und andererseits verkörperte Manu Dreyer einen Politikentwurf, der „grünkompatibel“ ist. Grüne Wählerinnen und Wähler konnten ohne Gesichtsverlust auch für Malu Dreyer stimmen.
Die, ich nenne es mal Malu-Dreyer-Option stellt sich für die SPD, je länger je mehr auch in anderen Bundesländern bzw. auf Bundesebene, denn je länger ein Winfried Kretschmann über zentrale Inhalte der grünen Politik mitentscheiden wird, desto deutlicher wird die Abkehr von den bisherigen programmatischen Inhalten werden. Wobei hier kein Missverständnis aufkommen soll: W.Kretschmann dient hier nur als ein Beispiel. Die Abkehr der grünen Partei von früher sakrosankten Inhalten findet auf allen politischen Ebenen statt. Die Partei wandelt sich, sie hat ihren Frieden mit dieser Republik gemacht. Das Wählerklientel altert ebenso sichtbar wie ihre Frontmänner und –frauen. Die Partei wird konservativer, wird beliebiger.
Um den absteigenden Ast noch etwas näher zu beschreiben, wenden wir uns dem hiesigen Bundesland zu:
Hier in NRW haben wir die spannende Situation, dass die Grünen im Lande mit der SPD koalieren, dass aber auf lokaler Ebene sich der ehemals linke Landesverband immer stärker für die CDU öffnet. Das wird, so kann vermutet werden, und die Kölner Grünen haben es vorgemacht, dazu führen, dass die Grünen ohne klare Koalitionsaussage in den Landtagswahlkampf gehen werden.
Für die SPD ist dies ein Risiko und eine Chance zugleich. Es wird zum Risiko, wenn die SPD in ihren alten politischen Bahnen verharrt und sich bspw. auf eine perspektivlose Verteidigung der rheinischen Braunkohleindustrie versteifen würde, wenn sie weiterhin als Vertreterin der hiesigen Großindustrie (Chemie, Eisen+Stahl Energie) wahr genommen wird, wenn sie sich zur Geisel der Energiemonopolisten machen lassen würde. Das mag den 63jährigen sozialdemokratischen Rentner in Essen oder Dortmund beruhigen, der mit dieser SPD groß und alt geworden ist, aber neue, andere, ökologisch orientierte Wählerschichten sind damit nicht zu gewinnen. Im Verhältnis zur Grünen Partei wird sich in diesem Falle nur wenig ändern. Die SPD ist in diesem Fall zwingend auf einen Koalitionspartner wie die Grünen angewiesen, der den modernisierungswilligen, den ökologischen Teil der Wählerschaft einfängt. Denn als wirtschaftlich strukturkonservative Partei wird sie diese Wählerinnen und Wähler nur schwer für sich gewinnen können.
Aber, in jeder Krise steckt auch eine Chance, insbesondere dann, wenn gute und möglicherweise wegweisende Vorschläge und Ideen von den eigenen Leuten produziert werden.
Erhard Eppler etwa erklärte in dem oben genannten Interview
„Ich habe ja – mit der Duldung von Willy Brandt – versucht, die Ökologie in der SPD heimisch zu machen. (…) ich bin nach wie vor der Meinung dass das Ökologische und das Soziale sehr wohl miteinander vereinbar sind. Meine Niederlage auf diesem Gebiet war der Sieg der GRÜNEN.“Was Erhard Eppler vor rund 40 Jahren versucht hat, die Verbindung von Ökologie mit dem Sozialen, eröffnet jetzt eine neue Chance für die SPD. Die Grüne Partei ist dabei, zentrale grüne Positionen zu räumen. Lange Jahre standen die Grünen für die Verbindung von Ökologie und Kapitalismuskritik, wurde Ökologie als Bestandteil einer Gegenideologie zur aktuell vorherrschenden Marktradikalismus verstanden, sollte die Welt mittels Ökologie zu einem sanften Kapitalismus verführt werden.
Das war einmal, das ist nicht mehr.
Oder anders formuliert: die Grünen räumen politische Positionen. Damit lassen sie Wählerinnen und Wähler heimatlos zurück. Hieraus kann man eine Chance herauslesen: wenn die SPD mit einem alternativen Gesellschaftsmodell zum Marktradikalismus, einem Modell, in dem das Ökologische mit dem Sozialen verknüpft wird, antreten würde und wenn hierfür eine Politikerin zur Verfügung steht, die eine solche Neuorientierung glaubwürdig verkörpert, dann bekommen die Grünen ein Problem, denn Teile ihrer Wählerschaft sind aufgrund des Rechtsdralls von einer so erneuerten SPD ansprechbar. Spätstens in diesem Moment erweist sich dann die Öffnung der GRÜNEN hin zur CDU als ein Bumerang, denn mit einer derart positionierten SPD steht den grünen Wählerinnen und Wählern erstmalig seit vielen Jahren wieder eine Alternative zur Verfügung.
Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz hat gezeigt, dass dieser Weg für die SPD erfolgreich begangen werden kann. Man muss ihn nur gehen.
Thema: Zuckungen
06. April 16 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
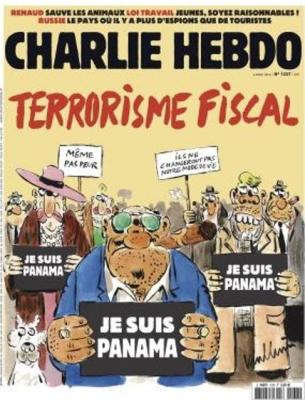
Thema: Grube Carl
18. März 16 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
Es laufen die Planungen für die Bebauung weiterer Baufelder auf Grube Carl.
Zwischen 2012 und 2014 existierte hierzu ein Planungsbeirat in dem Mitarbeiter der Verwaltung, der im Rat vertretenen Parteien und StadtteilbewohnerInnen sich über die weitere Ausgestaltung der zu bebauenden Flächen auseinandersetzten.
Eine der Prämissen lautete bspw. dass die weiteren Baufelder weniger dicht bebaut werden sollten als bspw. das Baufeld 4 (die jetzige Bebauung links und rechts der Straße „Zum Bellerhammer“). Ein zentrales Argument war dabei, dass bei weniger dichter Bebauung auch weniger Verkehrsbelastung bedeuten würde.
Die Vorschläge des Planungsbeirats wurden von allen Fraktionen begrüßt und gelobt. Selbst ein ausgewiesener Skeptiker wie der frühere Bürgermeister H.W. Meier kam nicht umhin, sich positiv zur Arbeit des Planungsbeirats zu äußern.
Doch es dauert noch nicht einmal 2 Jahre, da sind die damaligen Vorschläge nur noch Schall und Rauch.
Wie durfte man in eine Verwaltungsvorlage für die Ratssitzung vom 8. März 2016 lesen:
Das aber sind nachgeordnete Aspekte. Die Passage wird eingeleitet mit dem Hinweis, dass das städtebauliche Konzept „nicht hinreichend auf die wirtschaftlichen Aspekte abgestimmt“ sei. Gerüchte besagen, dass die ursprünglich erwarteten Quadratmeterpreise nicht zu erlösen seien. Das bedeutet, dass der Grundstücksverkäufer, in unserem Falle die stadteigene Stadtentwicklungsgesellschaft, weniger einnehmen würde, als geplant. Die Einnahmen aber, so wird behauptet, werden benötigt, um sukzessive die weiteren Baufelder entwickeln zu können. Vielleicht hat man auch damit gerechnet, dass die Stadtentwicklungsgesellschaft langfristig Gewinne erzielt. Wer weiß …. Aber alle diese Pläne und Erwartungen sind daran gebunden, dass der Verkaufspreis stimmt. Und hier hapert es. Wird nun die Bebauung verdichtet, so können höhere Grundstückspreise erzielt werden.
Andernfalls droht die Stadtentwicklungsgesellschaft zu einem Zuschussgeschäft für die Stadt selber zu werden.
Sollte sich diese Situation derart darstellen, dann ist es höchste Eisenbahn, Öffentlichkeit über die Situation der Stadtentwicklungsgesellschaft herzustellen.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Frechener Stadtentwicklungsgesellschaft sich verrechnet hat.
Eine Verdichtung, egal mit welcher Begründung bedeutet aber automatisch: mehr EinwohnerInnen, mehr Kinder, mehr Verkehr.
Die Bürgerinitiative „Planungsstopp“ hat auf die Zusammenhänge deutlich gemacht:
Vielmehr müssen die verschiedenen Problemlagen (Klimawandel, Verkehr, Wohnen, Erholung und Folgekosten) gesamthaft einer neuen Bewertung unterzogen werden.
Diese Aufgabe kann nicht von einer Stadtentwicklungsgesellschaft geleistet werden, deren Auftrag die Entwicklung und Vermarktung bebaubaren Landes ist, sondern dieser Aufgabe muss sich die Politik stellen.
Die Bürgerinitiative „Planungsstopp“ fordert daher zu Recht ein Planungsmoratorium, um eine gesamthafte Prüfung aller Planvorgaben vornehmen zu können.
Zur Onlinepetition
Zwischen 2012 und 2014 existierte hierzu ein Planungsbeirat in dem Mitarbeiter der Verwaltung, der im Rat vertretenen Parteien und StadtteilbewohnerInnen sich über die weitere Ausgestaltung der zu bebauenden Flächen auseinandersetzten.
Eine der Prämissen lautete bspw. dass die weiteren Baufelder weniger dicht bebaut werden sollten als bspw. das Baufeld 4 (die jetzige Bebauung links und rechts der Straße „Zum Bellerhammer“). Ein zentrales Argument war dabei, dass bei weniger dichter Bebauung auch weniger Verkehrsbelastung bedeuten würde.
Die Vorschläge des Planungsbeirats wurden von allen Fraktionen begrüßt und gelobt. Selbst ein ausgewiesener Skeptiker wie der frühere Bürgermeister H.W. Meier kam nicht umhin, sich positiv zur Arbeit des Planungsbeirats zu äußern.
Doch es dauert noch nicht einmal 2 Jahre, da sind die damaligen Vorschläge nur noch Schall und Rauch.
Wie durfte man in eine Verwaltungsvorlage für die Ratssitzung vom 8. März 2016 lesen:
Das aktuelle städtebauliche Konzept ‚Grube Carl‘ genügt nicht mehr den aktuellen Herausforderungen und ist auch nicht hinreichend auf die wirtschaftlichen Aspekte abgestimmt. Der Aufsichtsrat sieht die Erforderlichkeit, das städtebauliche Konzept hinsichtlich einer verträglichen Verdichtung und nachhaltigen Durchmischung zur Deckung einer bedarfsgerechten und auch bezahlbaren Wohnungsnachfrage (auch zur Integration von Flüchtlingen) zu analysieren und planerisch zu überarbeiten.In dieser Vorlage wird angekündigt, dass die Bebauung „verträglich“ verdichtet und dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll.
Das aber sind nachgeordnete Aspekte. Die Passage wird eingeleitet mit dem Hinweis, dass das städtebauliche Konzept „nicht hinreichend auf die wirtschaftlichen Aspekte abgestimmt“ sei. Gerüchte besagen, dass die ursprünglich erwarteten Quadratmeterpreise nicht zu erlösen seien. Das bedeutet, dass der Grundstücksverkäufer, in unserem Falle die stadteigene Stadtentwicklungsgesellschaft, weniger einnehmen würde, als geplant. Die Einnahmen aber, so wird behauptet, werden benötigt, um sukzessive die weiteren Baufelder entwickeln zu können. Vielleicht hat man auch damit gerechnet, dass die Stadtentwicklungsgesellschaft langfristig Gewinne erzielt. Wer weiß …. Aber alle diese Pläne und Erwartungen sind daran gebunden, dass der Verkaufspreis stimmt. Und hier hapert es. Wird nun die Bebauung verdichtet, so können höhere Grundstückspreise erzielt werden.
Andernfalls droht die Stadtentwicklungsgesellschaft zu einem Zuschussgeschäft für die Stadt selber zu werden.
Sollte sich diese Situation derart darstellen, dann ist es höchste Eisenbahn, Öffentlichkeit über die Situation der Stadtentwicklungsgesellschaft herzustellen.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Frechener Stadtentwicklungsgesellschaft sich verrechnet hat.
Eine Verdichtung, egal mit welcher Begründung bedeutet aber automatisch: mehr EinwohnerInnen, mehr Kinder, mehr Verkehr.
Die Bürgerinitiative „Planungsstopp“ hat auf die Zusammenhänge deutlich gemacht:
Die den Baugebieten nächstgelegene Lindenschule, wird aufgrund der beengten Lage am Standort, nur auf 3 Eingangsklassen erweitert. Wird auf Grube Carl gebaut, ist die Schule zu klein. Das heißt vereinfacht: die geplanten Wohnbaumaßnahmen im Frechener Westen sind bisher in den Schulplanungen nicht berücksichtigt.
Die Verkehrssituation im Stadtteil Grube Carl und der Rosmarstraße ist heute bereits Ursache vielfältiger Beschwerden. Die Verlängerung des Freiheitsrings steht in den Sternen und wird nicht zur Lösung des Problems beitragen. Die Bebauung weiterer Baufelder ohne klares Konzept, wird die Verkehrssituation in ganz Frechen verschlimmern.Darüber hinaus stellt sich aber bei den Planungen für das Gebiet Grube Carl die Frage, ob alle klimarelevanten Folgen einer Bebauung vor rund 20 Jahren hinreichend geprüft wurden. Man kann voraussetzen, dass der Klimawandel, der ja heute keine Zukunftsprognose, sondern spürbare Realität ist, vor 20 Jahren bei der Begutachtung der Flächen keine Rolle gespielt hat. Das Bundesumweltamt im vergangenen Jahr nicht umsonst im Rahmen eines Berichts über die Möglichkeiten der Anpassungen an den Klimawandel an deren besondere Verantwortung im Rahmen der Siedlungspolitik erinnert:
Eine besondere Verantwortung für das Siedlungsklima kommt den Kommunen zu. Positiven Einfluss können sie nehmen, indem sie z. B. bestehende grüne Flächen erhalten, miteinander vernetzen und zusätzlich neues Grün schaffen. Idealerweise sind die Grünflächen über Ventilationsbahnen an Kaltluftentstehungsgebiete wie Wiesen und Felder im ländlichen Umland angebunden.
Monitoringbericht zur deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel, Bundesumweltamt 2015, S. 47Der Ville-Osthang ist wegen seiner wesentlichen Klimafunktion von zentraler Bedeutung für die Belüftung der Frechener Kernstadt. Die unbebauten Flächen, sind unabdingbar für die hierzu notwendige Kaltluftentstehung, schreibt die Bürgerinitiative.
Die Bebauung wird negative Folgen für die die Luftqualität in der Innenstadt haben, denn ohne diese Flächen wird sich die Belüftung der Innenstadt verschlechtern – was mehrfach per Gutachten bestätigt worden ist. Hinzu kommen die Effekte des Klimawandels, so dass sich die Aufheizung der Innenstadt und eine höhere Schadstoffbelastung deutlich verstärken werdenZudem gilt für die Frechener Kernstadt, dass sie
über sehr wenige fußläufige Erholungsflächen verfügt und mit der Bebauung weiterer Gebiete in dieser Naturlandschaft, verliert Frechen eine weitere für Landschaftsbild und Erholung wichtige Fläche. Ausreichende Erholungs- und Ruheräume sind aber wichtig für die Lebensqualität aller Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt.Es scheint daher dringlich, die Bebauung des Stadtteils Grube Carl nochmals in seiner Gänze auf den Prüfstand zu stellen und dabei als zentralen Punkt nicht die „wirtschaftlichen Aspekte“ in den Mittelpunkt zu stellen, wie es die Verwaltung vorschlägt. Eine Betrachtung der Planungen alleine unter wirtschaftlichen Aspekten führt, die Verwaltungsvorlage ist eindeutig, zu verdichtetem Bauen und noch größeren Problemen.
Vielmehr müssen die verschiedenen Problemlagen (Klimawandel, Verkehr, Wohnen, Erholung und Folgekosten) gesamthaft einer neuen Bewertung unterzogen werden.
Diese Aufgabe kann nicht von einer Stadtentwicklungsgesellschaft geleistet werden, deren Auftrag die Entwicklung und Vermarktung bebaubaren Landes ist, sondern dieser Aufgabe muss sich die Politik stellen.
Die Bürgerinitiative „Planungsstopp“ fordert daher zu Recht ein Planungsmoratorium, um eine gesamthafte Prüfung aller Planvorgaben vornehmen zu können.
Zur Onlinepetition
Thema: Zuckungen
14. März 16 | Autor: antoine favier | 2 Kommentare | Kommentieren
Ja, früher war’s doch auch recht schön. Da gab es eine DDR und eine BRD und dazwischen war eine Mauer.
Für die in der DDR sicherlich nicht ganz so schön, haben wir im Westen auch so gesehen. Das Ding stand ja nur da rum, damit die Ossis das Arbeiter- und Bauernparadies nicht einfach so verlassen, um wie die Wessis auf Malle den Ballermann unsicher zu machen. So haben wir uns im Westen das vorgestellt und hatten zumindest Mitleid.
Und der Honecker? Der erklärte uns, es handle sich um einen „antifaschistischen Schutzwall“ und die im Westen seien die Faschisten und die im Osten die Guten, die Antifaschisten.
Und was haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelernt? Der Honni hatte teilweise Recht. Es handelte sich tatsächlich um einen antifaschistischen Schutzwall.
Nur dass die Faschisten im Osten sitzen …
Manchmal hätte man ihn gerne zurück, den antifaschistischen Schutzwall.
Für die in der DDR sicherlich nicht ganz so schön, haben wir im Westen auch so gesehen. Das Ding stand ja nur da rum, damit die Ossis das Arbeiter- und Bauernparadies nicht einfach so verlassen, um wie die Wessis auf Malle den Ballermann unsicher zu machen. So haben wir uns im Westen das vorgestellt und hatten zumindest Mitleid.
Und der Honecker? Der erklärte uns, es handle sich um einen „antifaschistischen Schutzwall“ und die im Westen seien die Faschisten und die im Osten die Guten, die Antifaschisten.
Und was haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelernt? Der Honni hatte teilweise Recht. Es handelte sich tatsächlich um einen antifaschistischen Schutzwall.
Nur dass die Faschisten im Osten sitzen …
Manchmal hätte man ihn gerne zurück, den antifaschistischen Schutzwall.
 Gegenentwürfe
Gegenentwürfe