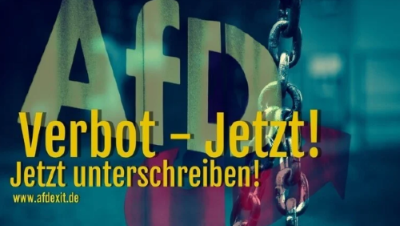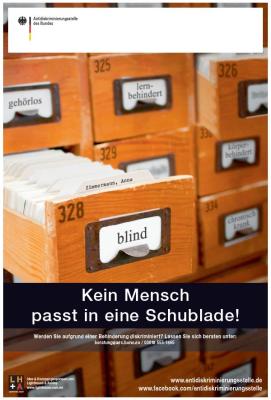Thema: SPD
21. Oktober 15 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
Der Begriff entstammt den Kommunikationswissenschaften und beschreibt den Einflussbereich der Medien. So haben Medien keinen großen Einfluss darauf, was die Menschen zu bestimmten Themen denken, aber sie haben einen erheblichen Einfluss darauf, worüber die Menschen nachdenken. Die Spiegelberichterstattung über das gekaufte „Sommermärchen WM 2006“ kann vermutlich als erfolgreiches Agenda-Setting gewertet werden. Zwar muss niemand daran glauben, dass der DFB bei der Vergabe der WM Entscheider mit finanziellen Zuwendungen unterstützt hätte, aber dass darüber breit geredet wird, das ist eindeutig.
Man kann den Begriff aber auch in den politischen Raum übertragen. Hier beschreibt er dann relativ zutreffend die Situation von Oppositionsparteien. Diese haben meist keinen entscheidenden Einfluss darauf, welche Entscheidungen zu bestimmten Themen in politischen Gremien getroffen werden, aber es muss einer Oppositionspartei gelingen, dass die Öffentlichkeit über ihre Themen redet.
Regierungsparteien haben ein Regierungsprogramm, einen Koalitionsvertrag, in dem die Ziele für die Legislaturperiode beschrieben sind, sozusagen die Regierungsagenda.
Und dann hat eine Regierung die von außen einschlagenden Themen, die behandelt werden müssen: ein Oderhochwasser, eine Wirtschaftskrise, ein Krieg vor der Haustüre oder ganz aktuell: Flüchtlinge.
Hier muss eine Regierung Handlungsfähigkeit beweisen. Oppositionsparteien stehen daneben und können den Gang der Ereignisse meist nur kommentierend begleiten.
Umso wichtiger ist es für Oppositionsparteien, eigene Themen zu platzieren, erfolgreiches Agenda-Setting zu betreiben.
Wenn man diese allgemeinen Überlegungen auf die lokale Ebene herunterbricht, so stellt man fest, dass sich eigentlich überraschend wenig ändert. Klar, die Dimensionen sind andere. Koalitionsverträge behandeln statt der Energiewende die energetische Sanierung von Gebäuden, statt Autobahnbau und Mautplänen geht es um die Sanierung von Straßen, um lokale Verkehrsentwicklungspläne und die Entwicklung der Innenstadt. Kriege sind weiter weg, die Wirtschaftskrise sieht vor der eigenen Haustüre etwas weniger dramatisch aus und lokal redet man nicht von einer halben Million Flüchtlingen, sondern von 300, die dringend ein festes Dach überm Kopf brauchen.
Aber Opposition hat ja eine funktionale Bedeutung in einer Demokratie, weswegen Claudia Stamm, MdL des bayerischen Landtags zu Recht befand, dass "eine Opposition an Berechtigung verliert, wenn sie auf Dauer simuliert, Regierung zu sein".
Das klingt nun zu groß für die Kommunalpolitik, behält aber doch seine Richtigkeit, weil auch auf kommunaler Ebene die grundsätzlichen Regeln der Demokratie nicht außer Kraft gesetzt sind. Innerhalb einer Demokratie bedarf es einer erkennbaren Gegenposition zu denjenigen Parteien, die das Heft des Handelns in der Hand haben. In Frechen ist dies die Jamaikakoalition und ihre Bürgermeisterin S.Stupp.
Das ist aber keine neue Situation. Das ist seit 1998 so, als der CDU-ler H.W.Meier zum Bürgermeister gewählt wurde und seine CDU die absolute Mehrheit im Rat gewann. Seitdem wartet Frechen auf eine Opposition, die ihrem Namen Ehre macht.
Gibt es irgendein Thema innerhalb der letzten 10 Jahre, das fest mit dem Namen der SPD verknüpft ist? Ist es der SPD in irgendeinem der Kommunalwahlkämpfe gelungen, ein eigenes Thema zu präsentieren, ein SPD-Thema sozusagen?
Und wie sah es im erst kürzlich beendeten SPD-Bürgermeisterwahlkampf aus? Gab es da ein Thema, das mit dem SPD-Kandidaten verknüpft worden ist?
Richtig, wer sich erinnert, wer durch die Presse blättert, steht vor dem „erstaunlichen“ Phänomen, dass die Frechener SPD seit rund 15 Jahren ohne eigene Themen durch die Gegend eiert. Es gibt nichts, aber man widerspreche mir, wenn ich mich täusche, es gibt kein politisches Thema, bei dem man sagen könnte: „Boaaa, da hat die SPD aber was auf’s Tableau gebracht, gut dass das endlich mal angesprochen wird.“ Nein, es findet sich nichts.
Es soll Menschen in Frechen gegeben haben, die beruflich bedingt während der Bürgermeisterwahl im Ausland weilten, zurückkamen, das Ergebnis zur Kenntnis nahmen und fragen: „Und, wer ist bei der SPD zurückgetreten?“
Die Folgenlosigkeit politischer Niederlagen in der lokalen SPD machte fassungslos.
Zusammen mit der, möglicherweise der Überalterung der SPD geschuldeten, politischen Konzeptionslosigkeit, ist es jedoch eine Gewähr dauerhafter Regierungsfähigkeit der aktuellen Jamaikakoalition. Die Oppositionsrolle in Frechen ist unbesetzt, womit aber auch die Funktionsfähigkeit demokratischer Prozesse in Frage gestellt ist.
Wer Wahlmüdigkeit, politische Abstinenz und die Auswüchse von Wutbürgertum beklagt, findet wesentliche Ursachen in der Selbstbeschädigung der Demokratie durch die Abdankung jeglicher Opposition.
Und das beginnt eben nicht erst in Düsseldorf oder Berlin. Das beginnt unten, an den Graswurzeln der Demokratie: in den Kommunen. Einer ernstzunehmenden Opposition muss es gelingen, eigene Themen zu setzen, erfolgreiches Agenda-Setting zu betrieben. Andernfalls braucht man sie nicht!
Ach ja, die JuSo-Bundesvorsitzende Johanna Ueckermann hat das sehr einfach zusammengefasst:
Man kann den Begriff aber auch in den politischen Raum übertragen. Hier beschreibt er dann relativ zutreffend die Situation von Oppositionsparteien. Diese haben meist keinen entscheidenden Einfluss darauf, welche Entscheidungen zu bestimmten Themen in politischen Gremien getroffen werden, aber es muss einer Oppositionspartei gelingen, dass die Öffentlichkeit über ihre Themen redet.
Regierungsparteien haben ein Regierungsprogramm, einen Koalitionsvertrag, in dem die Ziele für die Legislaturperiode beschrieben sind, sozusagen die Regierungsagenda.
Und dann hat eine Regierung die von außen einschlagenden Themen, die behandelt werden müssen: ein Oderhochwasser, eine Wirtschaftskrise, ein Krieg vor der Haustüre oder ganz aktuell: Flüchtlinge.
Hier muss eine Regierung Handlungsfähigkeit beweisen. Oppositionsparteien stehen daneben und können den Gang der Ereignisse meist nur kommentierend begleiten.
Umso wichtiger ist es für Oppositionsparteien, eigene Themen zu platzieren, erfolgreiches Agenda-Setting zu betreiben.
Wenn man diese allgemeinen Überlegungen auf die lokale Ebene herunterbricht, so stellt man fest, dass sich eigentlich überraschend wenig ändert. Klar, die Dimensionen sind andere. Koalitionsverträge behandeln statt der Energiewende die energetische Sanierung von Gebäuden, statt Autobahnbau und Mautplänen geht es um die Sanierung von Straßen, um lokale Verkehrsentwicklungspläne und die Entwicklung der Innenstadt. Kriege sind weiter weg, die Wirtschaftskrise sieht vor der eigenen Haustüre etwas weniger dramatisch aus und lokal redet man nicht von einer halben Million Flüchtlingen, sondern von 300, die dringend ein festes Dach überm Kopf brauchen.
Aber Opposition hat ja eine funktionale Bedeutung in einer Demokratie, weswegen Claudia Stamm, MdL des bayerischen Landtags zu Recht befand, dass "eine Opposition an Berechtigung verliert, wenn sie auf Dauer simuliert, Regierung zu sein".
Das klingt nun zu groß für die Kommunalpolitik, behält aber doch seine Richtigkeit, weil auch auf kommunaler Ebene die grundsätzlichen Regeln der Demokratie nicht außer Kraft gesetzt sind. Innerhalb einer Demokratie bedarf es einer erkennbaren Gegenposition zu denjenigen Parteien, die das Heft des Handelns in der Hand haben. In Frechen ist dies die Jamaikakoalition und ihre Bürgermeisterin S.Stupp.
Das ist aber keine neue Situation. Das ist seit 1998 so, als der CDU-ler H.W.Meier zum Bürgermeister gewählt wurde und seine CDU die absolute Mehrheit im Rat gewann. Seitdem wartet Frechen auf eine Opposition, die ihrem Namen Ehre macht.
Gibt es irgendein Thema innerhalb der letzten 10 Jahre, das fest mit dem Namen der SPD verknüpft ist? Ist es der SPD in irgendeinem der Kommunalwahlkämpfe gelungen, ein eigenes Thema zu präsentieren, ein SPD-Thema sozusagen?
Und wie sah es im erst kürzlich beendeten SPD-Bürgermeisterwahlkampf aus? Gab es da ein Thema, das mit dem SPD-Kandidaten verknüpft worden ist?
Richtig, wer sich erinnert, wer durch die Presse blättert, steht vor dem „erstaunlichen“ Phänomen, dass die Frechener SPD seit rund 15 Jahren ohne eigene Themen durch die Gegend eiert. Es gibt nichts, aber man widerspreche mir, wenn ich mich täusche, es gibt kein politisches Thema, bei dem man sagen könnte: „Boaaa, da hat die SPD aber was auf’s Tableau gebracht, gut dass das endlich mal angesprochen wird.“ Nein, es findet sich nichts.
Es soll Menschen in Frechen gegeben haben, die beruflich bedingt während der Bürgermeisterwahl im Ausland weilten, zurückkamen, das Ergebnis zur Kenntnis nahmen und fragen: „Und, wer ist bei der SPD zurückgetreten?“
Die Folgenlosigkeit politischer Niederlagen in der lokalen SPD machte fassungslos.
Zusammen mit der, möglicherweise der Überalterung der SPD geschuldeten, politischen Konzeptionslosigkeit, ist es jedoch eine Gewähr dauerhafter Regierungsfähigkeit der aktuellen Jamaikakoalition. Die Oppositionsrolle in Frechen ist unbesetzt, womit aber auch die Funktionsfähigkeit demokratischer Prozesse in Frage gestellt ist.
Wer Wahlmüdigkeit, politische Abstinenz und die Auswüchse von Wutbürgertum beklagt, findet wesentliche Ursachen in der Selbstbeschädigung der Demokratie durch die Abdankung jeglicher Opposition.
Und das beginnt eben nicht erst in Düsseldorf oder Berlin. Das beginnt unten, an den Graswurzeln der Demokratie: in den Kommunen. Einer ernstzunehmenden Opposition muss es gelingen, eigene Themen zu setzen, erfolgreiches Agenda-Setting zu betrieben. Andernfalls braucht man sie nicht!
Ach ja, die JuSo-Bundesvorsitzende Johanna Ueckermann hat das sehr einfach zusammengefasst:
Mein Eindruck ist: Der SPD fehlen vor allem zwei Dinge, Haltung und Mut. Sie will es sich mit niemandem verscherzen. Aber Wischiwaschi hilft uns nicht. Wir müssen aus unseren Überzeugungen heraus klare Positionen ableiten und für diese kämpfen. Wenn wir für etwas brennen, überzeugen wir auch andere.Und wofür brennt die Frechener SPD?
Thema: Zuckungen
02. Oktober 15 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
in Homs und Aleppo, die syrische Bevölkerung, wie sie demonstriert, mit Bannern, auf denen auf deutsch geschrieben steht:
LIEBER FASSBOMBEN ALS SACHLEISTUNGEN! WIR BLEIBEN HIER!
Doch, doch. So wird es kommen. Und falls sie es sich doch noch anders überlegen werden, die Menschen in Syrien, dann werden wir sie in Transitzonen an den Aussengrenzen der EU abfertigen. Sagt uns die Politik und alle "vernünftigen" Politker stimmen uns darauf ein, dass die Grenzen der "Belastbarkeit" erreicht seien. Und wer es bisher nicht glauben wollte, spätestens wenn alle, vom Grünen Kretschmann, über den Sozen Gabriel bis zum vor keinem rassistischen Klischee zurückschreckenden Seehofe,r uns unsere "Belastungsgrenze" vor Augen geführt haben, dann werden wir es glauben.
Und die Grünen marschieren inzwischen im Mainstream ganz weit vorne mit: Abscheid von der Grundrechtspartei
LIEBER FASSBOMBEN ALS SACHLEISTUNGEN! WIR BLEIBEN HIER!
Doch, doch. So wird es kommen. Und falls sie es sich doch noch anders überlegen werden, die Menschen in Syrien, dann werden wir sie in Transitzonen an den Aussengrenzen der EU abfertigen. Sagt uns die Politik und alle "vernünftigen" Politker stimmen uns darauf ein, dass die Grenzen der "Belastbarkeit" erreicht seien. Und wer es bisher nicht glauben wollte, spätestens wenn alle, vom Grünen Kretschmann, über den Sozen Gabriel bis zum vor keinem rassistischen Klischee zurückschreckenden Seehofe,r uns unsere "Belastungsgrenze" vor Augen geführt haben, dann werden wir es glauben.
Und die Grünen marschieren inzwischen im Mainstream ganz weit vorne mit: Abscheid von der Grundrechtspartei
Thema: Aus fremden Federn
18. September 15 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
von Ottmar Edenhofer
Kohle erlebt eine Renaissance - dank enorm hoher Subventionen. Das schadet dem Klima und den Menschen, kommentiert Ottmar Edenhofer vom Berliner Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Denn das Geld ließe sich besser nutzen.
Weniger als drei Monate vor Beginn der Weltklimakonferenz in Paris haben inzwischen Dutzende Staaten ihre nationalen Klimaschutzziele vorgelegt – darunter auch China und die USA. So manch einer wähnt bereits eine Wende für den weltweiten Klimaschutz zum Greifen nahe. Doch bislang sieht es nicht so aus, als ob das, was jetzt an Zugeständnissen der Staaten auf dem Tisch liegt, ausreichen würde, um die Erwärmung der globalen Mitteltemperatur auf nicht mehr als zwei Grad Celsius zu begrenzen.
Denn selbst wenn der politische Wille zum Klimaschutz in den kommenden Wochen noch deutlicher artikuliert wird – die Fakten sprechen derzeit leider eine andere Sprache: Wir erleben eine Renaissance der Kohle. Vor allem arme, aber schnell wachsende Entwicklungsländer investieren gerade massiv in den Bau neuer Kohlekraftwerke. Sie begeben sich damit auf eine Pfadabhängigkeit, die dem Weltklima noch über Jahrzehnte schwer zu schaffen machen wird. Konkret heißt das: Wenn nur ein Drittel der weltweiten Planungen von Kohlekraftwerken Realität wird, wäre das globale Kohlenstoffbudget zum Erreichen des Zwei-Grad-Ziels bereits nahezu aufgebraucht.
Denn insgesamt kann die Atmosphäre nur zirka 1000 Gigatonnen CO2 aufnehmen, wenn wir das Zwei-Grad-Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen wollen. Es lagern dagegen noch rund 15 000 Gigatonnen an CO2 in Form von fossilen Brennstoffen in der Erde. Mindestens 40 Prozent des Öls, 40 Prozent des Gases und vor allem 80 Prozent der andernfalls genutzten Kohle müssen also im Boden bleiben.
Weltweit subventionieren die Staaten Öl, Gas und Kohle mit 150 US-Dollar je Tonne CO2 – wenn man alle sozialen Kosten mit einrechnet
Danach sieht es momentan allerdings nicht aus – denn Kohle ist weltweit als Energielieferant spottbillig. Es gibt große Vorkommen, und der Kohlepreis ist relativ zu Erdgas oder erneuerbaren Energien sehr niedrig. Und vor allem: Weltweit subventionieren die Staaten den Einsatz von Öl, Gas und Kohle mit 150 US-Dollar je Tonne CO2, wenn man alle sozialen Kosten – beispielsweise Gesundheitsschäden – mit einrechnet.
Einer der wichtigsten Hebel für die internationale Klimapolitik ist daher die CO2-Bepreisung. Energie aus Kohle, Öl und Gas muss wesentlich teurer werden. In einem ersten Schritt wäre schon viel gewonnen, wenn zumindest die hohen Kohlesubventionen abgebaut würden. Am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) konnten wir zeigen, dass das allein schon ausreichen würde, um in den nächsten 15 Jahren in 70 Staaten der Welt den Menschen universellen Zugang zu Trinkwasser, in 60 zu funktionierenden Sanitäranlagen und in 50 zu Elektrizität zu ermöglichen. Wenn die Kohlesubventionen stattdessen in den Aufbau dieser Infrastrukturen gesteckt würden, wäre das ein hervorragendes Programm zur Armutsbekämpfung.
Auch die Industriestaaten würden von einer CO2-Bepreisung profitieren. Hier sind es vor allem die Finanzminister, die ein Interesse daran haben müssten – selbst wenn sich ihr Herz sonst nicht für die Klimapolitik erwärmt. Schließlich ist die CO2-Bepreisung eine äußerst effiziente Quelle zur Finanzierung von Staatshaushalten, ähnlich wie die Öko-Steuer zur Senkung der Lohnnebenkosten eingesetzt wird. Durch sie ließen sich beispielsweise Mittel für eine bessere Gesundheitsversorgung, die Stärkung des Bildungssektors oder die Verbesserung des öffentlichen Verkehrssystems bereitstellen. Wenn die Einnahmen in solche wirtschaftsfördernde Infrastrukturen fließen würden, könnten Unternehmen in solchen Ländern sogar langfristige Standortvorteile erwachsen.
Auf dem Weg zu einer globalen CO2-Bepreisung gilt es, zunächst zwei wesentliche Hürden zu nehmen. Erstens wäre es ein gutes politisches Signal, wenn über den Green Climate Fund Entwicklungsländer dafür bezahlt würden, dass sie einen weltweiten CO2-Preis akzeptieren. Mit diesem Geld könnten sie in die Technologieentwicklung und in ihre Wettbewerbsfähigkeit investieren. Zweitens wäre es wichtig, dass die Europäische Union mit gutem Beispiel vorangeht und das Europäische Emissionshandelssystem ETS reformiert. Hier brauchen wir vor allem einen stetig steigenden Mindestpreis. Auch eine sektorale Erweiterung des ETS auf den Transport- und Gebäudesektor könnte helfen, das System wieder flott zu machen.
Um langfristig zu einem globalen Klimaregime mit ambitionierten Stabilisierungszielen zu gelangen, sollten einzelne Staatengruppen mit einer CO2-Bepreisung als Vorreiter aktiv werden. Denn der Nutzen von Klimapolitik offenbart sich erst sehr spät. Wer jetzt aber Kohle teurer macht, der kann davon schon relativ schnell profitieren.
Prof. Dr. Ottmar Edenhofer ist Direktor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) sowie Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Lehrstuhlinhaber für die Ökonomie des Klimawandels an der Technischen Universität Berlin.
© Spektrum.de
Quelle
Kohle erlebt eine Renaissance - dank enorm hoher Subventionen. Das schadet dem Klima und den Menschen, kommentiert Ottmar Edenhofer vom Berliner Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Denn das Geld ließe sich besser nutzen.
Weniger als drei Monate vor Beginn der Weltklimakonferenz in Paris haben inzwischen Dutzende Staaten ihre nationalen Klimaschutzziele vorgelegt – darunter auch China und die USA. So manch einer wähnt bereits eine Wende für den weltweiten Klimaschutz zum Greifen nahe. Doch bislang sieht es nicht so aus, als ob das, was jetzt an Zugeständnissen der Staaten auf dem Tisch liegt, ausreichen würde, um die Erwärmung der globalen Mitteltemperatur auf nicht mehr als zwei Grad Celsius zu begrenzen.
Denn selbst wenn der politische Wille zum Klimaschutz in den kommenden Wochen noch deutlicher artikuliert wird – die Fakten sprechen derzeit leider eine andere Sprache: Wir erleben eine Renaissance der Kohle. Vor allem arme, aber schnell wachsende Entwicklungsländer investieren gerade massiv in den Bau neuer Kohlekraftwerke. Sie begeben sich damit auf eine Pfadabhängigkeit, die dem Weltklima noch über Jahrzehnte schwer zu schaffen machen wird. Konkret heißt das: Wenn nur ein Drittel der weltweiten Planungen von Kohlekraftwerken Realität wird, wäre das globale Kohlenstoffbudget zum Erreichen des Zwei-Grad-Ziels bereits nahezu aufgebraucht.
Denn insgesamt kann die Atmosphäre nur zirka 1000 Gigatonnen CO2 aufnehmen, wenn wir das Zwei-Grad-Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen wollen. Es lagern dagegen noch rund 15 000 Gigatonnen an CO2 in Form von fossilen Brennstoffen in der Erde. Mindestens 40 Prozent des Öls, 40 Prozent des Gases und vor allem 80 Prozent der andernfalls genutzten Kohle müssen also im Boden bleiben.
Weltweit subventionieren die Staaten Öl, Gas und Kohle mit 150 US-Dollar je Tonne CO2 – wenn man alle sozialen Kosten mit einrechnet
Danach sieht es momentan allerdings nicht aus – denn Kohle ist weltweit als Energielieferant spottbillig. Es gibt große Vorkommen, und der Kohlepreis ist relativ zu Erdgas oder erneuerbaren Energien sehr niedrig. Und vor allem: Weltweit subventionieren die Staaten den Einsatz von Öl, Gas und Kohle mit 150 US-Dollar je Tonne CO2, wenn man alle sozialen Kosten – beispielsweise Gesundheitsschäden – mit einrechnet.
Einer der wichtigsten Hebel für die internationale Klimapolitik ist daher die CO2-Bepreisung. Energie aus Kohle, Öl und Gas muss wesentlich teurer werden. In einem ersten Schritt wäre schon viel gewonnen, wenn zumindest die hohen Kohlesubventionen abgebaut würden. Am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) konnten wir zeigen, dass das allein schon ausreichen würde, um in den nächsten 15 Jahren in 70 Staaten der Welt den Menschen universellen Zugang zu Trinkwasser, in 60 zu funktionierenden Sanitäranlagen und in 50 zu Elektrizität zu ermöglichen. Wenn die Kohlesubventionen stattdessen in den Aufbau dieser Infrastrukturen gesteckt würden, wäre das ein hervorragendes Programm zur Armutsbekämpfung.
Auch die Industriestaaten würden von einer CO2-Bepreisung profitieren. Hier sind es vor allem die Finanzminister, die ein Interesse daran haben müssten – selbst wenn sich ihr Herz sonst nicht für die Klimapolitik erwärmt. Schließlich ist die CO2-Bepreisung eine äußerst effiziente Quelle zur Finanzierung von Staatshaushalten, ähnlich wie die Öko-Steuer zur Senkung der Lohnnebenkosten eingesetzt wird. Durch sie ließen sich beispielsweise Mittel für eine bessere Gesundheitsversorgung, die Stärkung des Bildungssektors oder die Verbesserung des öffentlichen Verkehrssystems bereitstellen. Wenn die Einnahmen in solche wirtschaftsfördernde Infrastrukturen fließen würden, könnten Unternehmen in solchen Ländern sogar langfristige Standortvorteile erwachsen.
Auf dem Weg zu einer globalen CO2-Bepreisung gilt es, zunächst zwei wesentliche Hürden zu nehmen. Erstens wäre es ein gutes politisches Signal, wenn über den Green Climate Fund Entwicklungsländer dafür bezahlt würden, dass sie einen weltweiten CO2-Preis akzeptieren. Mit diesem Geld könnten sie in die Technologieentwicklung und in ihre Wettbewerbsfähigkeit investieren. Zweitens wäre es wichtig, dass die Europäische Union mit gutem Beispiel vorangeht und das Europäische Emissionshandelssystem ETS reformiert. Hier brauchen wir vor allem einen stetig steigenden Mindestpreis. Auch eine sektorale Erweiterung des ETS auf den Transport- und Gebäudesektor könnte helfen, das System wieder flott zu machen.
Um langfristig zu einem globalen Klimaregime mit ambitionierten Stabilisierungszielen zu gelangen, sollten einzelne Staatengruppen mit einer CO2-Bepreisung als Vorreiter aktiv werden. Denn der Nutzen von Klimapolitik offenbart sich erst sehr spät. Wer jetzt aber Kohle teurer macht, der kann davon schon relativ schnell profitieren.
Prof. Dr. Ottmar Edenhofer ist Direktor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) sowie Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Lehrstuhlinhaber für die Ökonomie des Klimawandels an der Technischen Universität Berlin.
© Spektrum.de
Quelle
 Gegenentwürfe
Gegenentwürfe