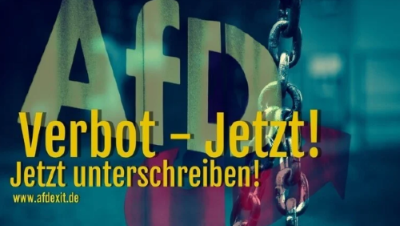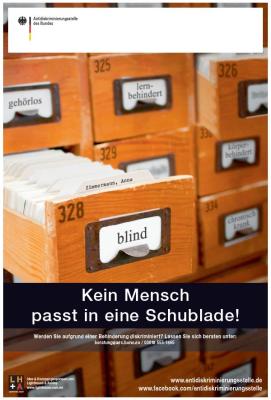Thema: Zuckungen
02. Oktober 15 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
in Homs und Aleppo, die syrische Bevölkerung, wie sie demonstriert, mit Bannern, auf denen auf deutsch geschrieben steht:
LIEBER FASSBOMBEN ALS SACHLEISTUNGEN! WIR BLEIBEN HIER!
Doch, doch. So wird es kommen. Und falls sie es sich doch noch anders überlegen werden, die Menschen in Syrien, dann werden wir sie in Transitzonen an den Aussengrenzen der EU abfertigen. Sagt uns die Politik und alle "vernünftigen" Politker stimmen uns darauf ein, dass die Grenzen der "Belastbarkeit" erreicht seien. Und wer es bisher nicht glauben wollte, spätestens wenn alle, vom Grünen Kretschmann, über den Sozen Gabriel bis zum vor keinem rassistischen Klischee zurückschreckenden Seehofe,r uns unsere "Belastungsgrenze" vor Augen geführt haben, dann werden wir es glauben.
Und die Grünen marschieren inzwischen im Mainstream ganz weit vorne mit: Abscheid von der Grundrechtspartei
LIEBER FASSBOMBEN ALS SACHLEISTUNGEN! WIR BLEIBEN HIER!
Doch, doch. So wird es kommen. Und falls sie es sich doch noch anders überlegen werden, die Menschen in Syrien, dann werden wir sie in Transitzonen an den Aussengrenzen der EU abfertigen. Sagt uns die Politik und alle "vernünftigen" Politker stimmen uns darauf ein, dass die Grenzen der "Belastbarkeit" erreicht seien. Und wer es bisher nicht glauben wollte, spätestens wenn alle, vom Grünen Kretschmann, über den Sozen Gabriel bis zum vor keinem rassistischen Klischee zurückschreckenden Seehofe,r uns unsere "Belastungsgrenze" vor Augen geführt haben, dann werden wir es glauben.
Und die Grünen marschieren inzwischen im Mainstream ganz weit vorne mit: Abscheid von der Grundrechtspartei
Thema: Aus fremden Federn
18. September 15 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
von Ottmar Edenhofer
Kohle erlebt eine Renaissance - dank enorm hoher Subventionen. Das schadet dem Klima und den Menschen, kommentiert Ottmar Edenhofer vom Berliner Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Denn das Geld ließe sich besser nutzen.
Weniger als drei Monate vor Beginn der Weltklimakonferenz in Paris haben inzwischen Dutzende Staaten ihre nationalen Klimaschutzziele vorgelegt – darunter auch China und die USA. So manch einer wähnt bereits eine Wende für den weltweiten Klimaschutz zum Greifen nahe. Doch bislang sieht es nicht so aus, als ob das, was jetzt an Zugeständnissen der Staaten auf dem Tisch liegt, ausreichen würde, um die Erwärmung der globalen Mitteltemperatur auf nicht mehr als zwei Grad Celsius zu begrenzen.
Denn selbst wenn der politische Wille zum Klimaschutz in den kommenden Wochen noch deutlicher artikuliert wird – die Fakten sprechen derzeit leider eine andere Sprache: Wir erleben eine Renaissance der Kohle. Vor allem arme, aber schnell wachsende Entwicklungsländer investieren gerade massiv in den Bau neuer Kohlekraftwerke. Sie begeben sich damit auf eine Pfadabhängigkeit, die dem Weltklima noch über Jahrzehnte schwer zu schaffen machen wird. Konkret heißt das: Wenn nur ein Drittel der weltweiten Planungen von Kohlekraftwerken Realität wird, wäre das globale Kohlenstoffbudget zum Erreichen des Zwei-Grad-Ziels bereits nahezu aufgebraucht.
Denn insgesamt kann die Atmosphäre nur zirka 1000 Gigatonnen CO2 aufnehmen, wenn wir das Zwei-Grad-Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen wollen. Es lagern dagegen noch rund 15 000 Gigatonnen an CO2 in Form von fossilen Brennstoffen in der Erde. Mindestens 40 Prozent des Öls, 40 Prozent des Gases und vor allem 80 Prozent der andernfalls genutzten Kohle müssen also im Boden bleiben.
Weltweit subventionieren die Staaten Öl, Gas und Kohle mit 150 US-Dollar je Tonne CO2 – wenn man alle sozialen Kosten mit einrechnet
Danach sieht es momentan allerdings nicht aus – denn Kohle ist weltweit als Energielieferant spottbillig. Es gibt große Vorkommen, und der Kohlepreis ist relativ zu Erdgas oder erneuerbaren Energien sehr niedrig. Und vor allem: Weltweit subventionieren die Staaten den Einsatz von Öl, Gas und Kohle mit 150 US-Dollar je Tonne CO2, wenn man alle sozialen Kosten – beispielsweise Gesundheitsschäden – mit einrechnet.
Einer der wichtigsten Hebel für die internationale Klimapolitik ist daher die CO2-Bepreisung. Energie aus Kohle, Öl und Gas muss wesentlich teurer werden. In einem ersten Schritt wäre schon viel gewonnen, wenn zumindest die hohen Kohlesubventionen abgebaut würden. Am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) konnten wir zeigen, dass das allein schon ausreichen würde, um in den nächsten 15 Jahren in 70 Staaten der Welt den Menschen universellen Zugang zu Trinkwasser, in 60 zu funktionierenden Sanitäranlagen und in 50 zu Elektrizität zu ermöglichen. Wenn die Kohlesubventionen stattdessen in den Aufbau dieser Infrastrukturen gesteckt würden, wäre das ein hervorragendes Programm zur Armutsbekämpfung.
Auch die Industriestaaten würden von einer CO2-Bepreisung profitieren. Hier sind es vor allem die Finanzminister, die ein Interesse daran haben müssten – selbst wenn sich ihr Herz sonst nicht für die Klimapolitik erwärmt. Schließlich ist die CO2-Bepreisung eine äußerst effiziente Quelle zur Finanzierung von Staatshaushalten, ähnlich wie die Öko-Steuer zur Senkung der Lohnnebenkosten eingesetzt wird. Durch sie ließen sich beispielsweise Mittel für eine bessere Gesundheitsversorgung, die Stärkung des Bildungssektors oder die Verbesserung des öffentlichen Verkehrssystems bereitstellen. Wenn die Einnahmen in solche wirtschaftsfördernde Infrastrukturen fließen würden, könnten Unternehmen in solchen Ländern sogar langfristige Standortvorteile erwachsen.
Auf dem Weg zu einer globalen CO2-Bepreisung gilt es, zunächst zwei wesentliche Hürden zu nehmen. Erstens wäre es ein gutes politisches Signal, wenn über den Green Climate Fund Entwicklungsländer dafür bezahlt würden, dass sie einen weltweiten CO2-Preis akzeptieren. Mit diesem Geld könnten sie in die Technologieentwicklung und in ihre Wettbewerbsfähigkeit investieren. Zweitens wäre es wichtig, dass die Europäische Union mit gutem Beispiel vorangeht und das Europäische Emissionshandelssystem ETS reformiert. Hier brauchen wir vor allem einen stetig steigenden Mindestpreis. Auch eine sektorale Erweiterung des ETS auf den Transport- und Gebäudesektor könnte helfen, das System wieder flott zu machen.
Um langfristig zu einem globalen Klimaregime mit ambitionierten Stabilisierungszielen zu gelangen, sollten einzelne Staatengruppen mit einer CO2-Bepreisung als Vorreiter aktiv werden. Denn der Nutzen von Klimapolitik offenbart sich erst sehr spät. Wer jetzt aber Kohle teurer macht, der kann davon schon relativ schnell profitieren.
Prof. Dr. Ottmar Edenhofer ist Direktor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) sowie Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Lehrstuhlinhaber für die Ökonomie des Klimawandels an der Technischen Universität Berlin.
© Spektrum.de
Quelle
Kohle erlebt eine Renaissance - dank enorm hoher Subventionen. Das schadet dem Klima und den Menschen, kommentiert Ottmar Edenhofer vom Berliner Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Denn das Geld ließe sich besser nutzen.
Weniger als drei Monate vor Beginn der Weltklimakonferenz in Paris haben inzwischen Dutzende Staaten ihre nationalen Klimaschutzziele vorgelegt – darunter auch China und die USA. So manch einer wähnt bereits eine Wende für den weltweiten Klimaschutz zum Greifen nahe. Doch bislang sieht es nicht so aus, als ob das, was jetzt an Zugeständnissen der Staaten auf dem Tisch liegt, ausreichen würde, um die Erwärmung der globalen Mitteltemperatur auf nicht mehr als zwei Grad Celsius zu begrenzen.
Denn selbst wenn der politische Wille zum Klimaschutz in den kommenden Wochen noch deutlicher artikuliert wird – die Fakten sprechen derzeit leider eine andere Sprache: Wir erleben eine Renaissance der Kohle. Vor allem arme, aber schnell wachsende Entwicklungsländer investieren gerade massiv in den Bau neuer Kohlekraftwerke. Sie begeben sich damit auf eine Pfadabhängigkeit, die dem Weltklima noch über Jahrzehnte schwer zu schaffen machen wird. Konkret heißt das: Wenn nur ein Drittel der weltweiten Planungen von Kohlekraftwerken Realität wird, wäre das globale Kohlenstoffbudget zum Erreichen des Zwei-Grad-Ziels bereits nahezu aufgebraucht.
Denn insgesamt kann die Atmosphäre nur zirka 1000 Gigatonnen CO2 aufnehmen, wenn wir das Zwei-Grad-Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen wollen. Es lagern dagegen noch rund 15 000 Gigatonnen an CO2 in Form von fossilen Brennstoffen in der Erde. Mindestens 40 Prozent des Öls, 40 Prozent des Gases und vor allem 80 Prozent der andernfalls genutzten Kohle müssen also im Boden bleiben.
Weltweit subventionieren die Staaten Öl, Gas und Kohle mit 150 US-Dollar je Tonne CO2 – wenn man alle sozialen Kosten mit einrechnet
Danach sieht es momentan allerdings nicht aus – denn Kohle ist weltweit als Energielieferant spottbillig. Es gibt große Vorkommen, und der Kohlepreis ist relativ zu Erdgas oder erneuerbaren Energien sehr niedrig. Und vor allem: Weltweit subventionieren die Staaten den Einsatz von Öl, Gas und Kohle mit 150 US-Dollar je Tonne CO2, wenn man alle sozialen Kosten – beispielsweise Gesundheitsschäden – mit einrechnet.
Einer der wichtigsten Hebel für die internationale Klimapolitik ist daher die CO2-Bepreisung. Energie aus Kohle, Öl und Gas muss wesentlich teurer werden. In einem ersten Schritt wäre schon viel gewonnen, wenn zumindest die hohen Kohlesubventionen abgebaut würden. Am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) konnten wir zeigen, dass das allein schon ausreichen würde, um in den nächsten 15 Jahren in 70 Staaten der Welt den Menschen universellen Zugang zu Trinkwasser, in 60 zu funktionierenden Sanitäranlagen und in 50 zu Elektrizität zu ermöglichen. Wenn die Kohlesubventionen stattdessen in den Aufbau dieser Infrastrukturen gesteckt würden, wäre das ein hervorragendes Programm zur Armutsbekämpfung.
Auch die Industriestaaten würden von einer CO2-Bepreisung profitieren. Hier sind es vor allem die Finanzminister, die ein Interesse daran haben müssten – selbst wenn sich ihr Herz sonst nicht für die Klimapolitik erwärmt. Schließlich ist die CO2-Bepreisung eine äußerst effiziente Quelle zur Finanzierung von Staatshaushalten, ähnlich wie die Öko-Steuer zur Senkung der Lohnnebenkosten eingesetzt wird. Durch sie ließen sich beispielsweise Mittel für eine bessere Gesundheitsversorgung, die Stärkung des Bildungssektors oder die Verbesserung des öffentlichen Verkehrssystems bereitstellen. Wenn die Einnahmen in solche wirtschaftsfördernde Infrastrukturen fließen würden, könnten Unternehmen in solchen Ländern sogar langfristige Standortvorteile erwachsen.
Auf dem Weg zu einer globalen CO2-Bepreisung gilt es, zunächst zwei wesentliche Hürden zu nehmen. Erstens wäre es ein gutes politisches Signal, wenn über den Green Climate Fund Entwicklungsländer dafür bezahlt würden, dass sie einen weltweiten CO2-Preis akzeptieren. Mit diesem Geld könnten sie in die Technologieentwicklung und in ihre Wettbewerbsfähigkeit investieren. Zweitens wäre es wichtig, dass die Europäische Union mit gutem Beispiel vorangeht und das Europäische Emissionshandelssystem ETS reformiert. Hier brauchen wir vor allem einen stetig steigenden Mindestpreis. Auch eine sektorale Erweiterung des ETS auf den Transport- und Gebäudesektor könnte helfen, das System wieder flott zu machen.
Um langfristig zu einem globalen Klimaregime mit ambitionierten Stabilisierungszielen zu gelangen, sollten einzelne Staatengruppen mit einer CO2-Bepreisung als Vorreiter aktiv werden. Denn der Nutzen von Klimapolitik offenbart sich erst sehr spät. Wer jetzt aber Kohle teurer macht, der kann davon schon relativ schnell profitieren.
Prof. Dr. Ottmar Edenhofer ist Direktor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) sowie Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Lehrstuhlinhaber für die Ökonomie des Klimawandels an der Technischen Universität Berlin.
© Spektrum.de
Quelle
Thema: Gesamtschule
16. September 15 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
Bereits im Oktober 2014 hat das Aktionsbündnis für eine Gesamtschule den inzwischen von allen Fraktionen unterstützen Weg zu einer Gesamtschule für Frechen skizziert.
Einzig bei der Größe der Gesamtschule besteht noch ein massiver Dissens zwischen den Vorstellungen des Aktionsbündnisses für eine Gesamtschule in Frechen und den Vorstellungen von Jamaika-Koalition und Verwaltung.
Das Aktionsbündnis hat in der Presseerklärung bereits 2014 erklärt:
In mehreren Artikeln hier im Blog (zuletzt) wurde darauf hingewiesen, dass bereits das bisher dokumentierte Elterninteresse für eine mindestens sechszügige Schule spricht.
Das aber reicht nicht aus, um in der Stadtspitze ein Umdenken einzuleiten.
Es kommt aber noch schlimmer …. Die noch nicht bestehende Gesamtschule wird bereits heute mit Erwartungen überfrachtet, die eine kleine Gesamtschule, und mit vier Zügen handelt es sich um eine kleine Gesamtschule, nicht erfüllen kann.
Beispielhaft sei auf die Podiumsdiskussion am 7. September 2015 verwiesen, als die nun ins Bürgermeisteramt gewählte S.Stupp auf die Schließung der Hauptschule angesprochen wurde und dabei auf die gute Arbeit, die die Hauptschule bei der Inklusion und der Integration von Flüchtlingskindern leiste, verwiesen wurde. Da hat die Schule bspw. kurzfristig eine eigene Klasse mit inzwischen wohl 20 Flüchtlingskindern eingerichtet.
Das ändert nun nichts daran, dass die Eltern der Grundschulkinder ihre Kinder lieber auf einer Gesamtschule unterrichtet sehen als auf einer Hauptschule, es wird aber zum Problem, wenn die neue Bürgermeisterin erklärt, dass sie hoffe, dass die Gesamtschule doch solche Aufgaben in der gleichen Qualität fortführe wie die Hauptschule es heute mache.
D’accord kann man nur sagen, ja die Gesamtschule hat hier eine besondere gesellschaftliche Verantwortung, nachdem sich die eine oder andere der Frechener Schulen dieser Verantwortung entzieht. Man muss einer Schule dann aber auch den Rahmen geben, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Andernfalls ist das Scheitern vorprogrammiert.
Und hier ist die Politik in der Verantwortung: Eine Frechener Gesamtschule, wenn sie denn als Gesamtschule funktionieren soll und gleichzeitig im Schwerpunkt Inklusions- und Integrationsaufgaben übernehmen soll, die andere Schulen gerne links liegen lassen, muss eine ausreichende Größe haben, um allen Kindern, auch denen ohne Inklusions- und Integrationsbedarf, gerecht zu werden.
Eine vierzügige Gesamtschule ist hierfür eindeutig zu klein.
Es wird Zeit, dass die Stadtoberen diesen Zielkonflikt auflösen und die Planungen der Gesamtschule auf eine Sechszügigkeit erweitern. Andernfalls besteht das Risiko, dass weder die Integration von Zuwandererkindern noch die Inklusion von behinderten Kindern funktionieren kann.
Einzig bei der Größe der Gesamtschule besteht noch ein massiver Dissens zwischen den Vorstellungen des Aktionsbündnisses für eine Gesamtschule in Frechen und den Vorstellungen von Jamaika-Koalition und Verwaltung.
Das Aktionsbündnis hat in der Presseerklärung bereits 2014 erklärt:
Einzig eine große Gesamtschule (6 Züge) kann die Frechener Schulprobleme lösen."Es muss bezahlbar bleiben", also die Einführung einer Gesamtschule darf den Haushalt der Stadt nicht zu sehr belasten, so das Argument von Koalition und Verwaltung, weswegen die Gesamtschule nur mit vier Klassen starten soll.
In mehreren Artikeln hier im Blog (zuletzt) wurde darauf hingewiesen, dass bereits das bisher dokumentierte Elterninteresse für eine mindestens sechszügige Schule spricht.
Das aber reicht nicht aus, um in der Stadtspitze ein Umdenken einzuleiten.
Es kommt aber noch schlimmer …. Die noch nicht bestehende Gesamtschule wird bereits heute mit Erwartungen überfrachtet, die eine kleine Gesamtschule, und mit vier Zügen handelt es sich um eine kleine Gesamtschule, nicht erfüllen kann.
Beispielhaft sei auf die Podiumsdiskussion am 7. September 2015 verwiesen, als die nun ins Bürgermeisteramt gewählte S.Stupp auf die Schließung der Hauptschule angesprochen wurde und dabei auf die gute Arbeit, die die Hauptschule bei der Inklusion und der Integration von Flüchtlingskindern leiste, verwiesen wurde. Da hat die Schule bspw. kurzfristig eine eigene Klasse mit inzwischen wohl 20 Flüchtlingskindern eingerichtet.
Das ändert nun nichts daran, dass die Eltern der Grundschulkinder ihre Kinder lieber auf einer Gesamtschule unterrichtet sehen als auf einer Hauptschule, es wird aber zum Problem, wenn die neue Bürgermeisterin erklärt, dass sie hoffe, dass die Gesamtschule doch solche Aufgaben in der gleichen Qualität fortführe wie die Hauptschule es heute mache.
D’accord kann man nur sagen, ja die Gesamtschule hat hier eine besondere gesellschaftliche Verantwortung, nachdem sich die eine oder andere der Frechener Schulen dieser Verantwortung entzieht. Man muss einer Schule dann aber auch den Rahmen geben, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Andernfalls ist das Scheitern vorprogrammiert.
Und hier ist die Politik in der Verantwortung: Eine Frechener Gesamtschule, wenn sie denn als Gesamtschule funktionieren soll und gleichzeitig im Schwerpunkt Inklusions- und Integrationsaufgaben übernehmen soll, die andere Schulen gerne links liegen lassen, muss eine ausreichende Größe haben, um allen Kindern, auch denen ohne Inklusions- und Integrationsbedarf, gerecht zu werden.
Eine vierzügige Gesamtschule ist hierfür eindeutig zu klein.
Es wird Zeit, dass die Stadtoberen diesen Zielkonflikt auflösen und die Planungen der Gesamtschule auf eine Sechszügigkeit erweitern. Andernfalls besteht das Risiko, dass weder die Integration von Zuwandererkindern noch die Inklusion von behinderten Kindern funktionieren kann.
 Gegenentwürfe
Gegenentwürfe