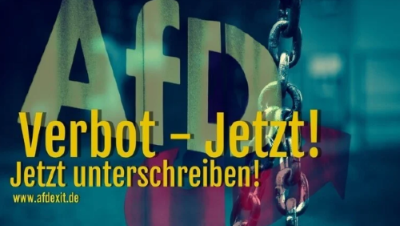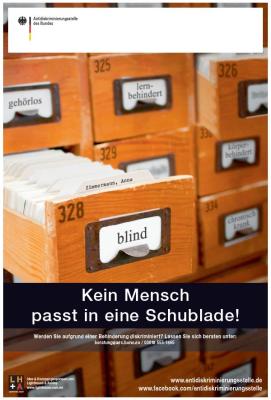Thema: Briefe an die LeserInnen
11. September 15 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
was durfte ich denn in eurem Brief an die „liebe Erstwählerin, lieber Erstwähler“ lesen?
Ihr empfehlt dieser Zielgruppe Susanne Stupp mit dem Argument sie sein „noch jung genug, um die Anliegen der Jugend zu kennen“?
Nun weiß ich ja, dass der Begriff „jung“ unterschiedlich belegt ist, mit 34 ist man in der CDU noch „jung“, im Tennis dagegen bereits bei den Senioren (bis 35 gilt man noch als „Jung-Senior“, immerhin). Zu Recht hieß es früher „glaub‘ keinem über dreißig.“
Nun ist Frau Stupp aber 46 Jahre alt. Da kann sie nix für, aber jung ist anders und jung geblieben ist oft genug eine Frage von Selbst- und Fremdwahrnehmung …… Also, despektierlich gesprochen reden wir hier über die Generation der Gruftis.
(… und ja, der Blogger gehört da auch dazu.)
Und mal ehrlich, war der Wahlkampf irgendwie jugendbewegt?
Oder beschreibt das Bild vom Publikum der letzten Podiumsdiskussion die Situation nicht besser:

Nachweis
Ein Wahlkampf für angehende und vollendete RentnerInnen?
Ihr empfehlt dieser Zielgruppe Susanne Stupp mit dem Argument sie sein „noch jung genug, um die Anliegen der Jugend zu kennen“?
Nun weiß ich ja, dass der Begriff „jung“ unterschiedlich belegt ist, mit 34 ist man in der CDU noch „jung“, im Tennis dagegen bereits bei den Senioren (bis 35 gilt man noch als „Jung-Senior“, immerhin). Zu Recht hieß es früher „glaub‘ keinem über dreißig.“
Nun ist Frau Stupp aber 46 Jahre alt. Da kann sie nix für, aber jung ist anders und jung geblieben ist oft genug eine Frage von Selbst- und Fremdwahrnehmung …… Also, despektierlich gesprochen reden wir hier über die Generation der Gruftis.
(… und ja, der Blogger gehört da auch dazu.)
Und mal ehrlich, war der Wahlkampf irgendwie jugendbewegt?
Oder beschreibt das Bild vom Publikum der letzten Podiumsdiskussion die Situation nicht besser:

Nachweis
Ein Wahlkampf für angehende und vollendete RentnerInnen?
Thema: Buergermeisterwahl 2015
08. September 15 | Autor: antoine favier | 2 Kommentare | Kommentieren
Man kann es wohl nicht oft genug sagen und lesen und nun auch im Spiegel bei Wolfgang Münchau:
Gestern bei der Podiumsdebatte der Frechener Bürgermeisterkandidaten wurde man Zeuge zu welchen Schizophrenien die tiefe Verankerung neoliberalen Denkens in der Kommunalpolitik führen kann.
So sang die CDU-Kandidatin Frau Stupp, als es um die Frage der Kommunalfinanzen ging, ein Hohelied auf das Königsrecht eines jeden Kommunalparlaments, also das Recht, einen eigenen Haushalt verabschieden zu dürfen. Einfach formuliert verlieren Kommunen dieses Recht, wenn sie keinen ausgeglichenen Haushalt präsentieren können: sie kommen unter staatliche Kuratel. Frau Stupp will nicht, dass Frechen unter staatliche Kuratel kommt. Also will sie weiterhin ausgeglichene Haushalte präsentieren. Das aber ist schwierig, denn Kommunen müssen viele Aufgaben erledigen, die ihnen vom Land oder vom Bund zugewiesen werden. (bspw. im sozialen Bereich). Leider vergessen Bund und Land aber, den Kommunen hierfür ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.
Alles richtig und doch alles falsch, denn Bund und Länder sind laut den von den Konservativen gewollten Verfassungsänderungen gezwungen, ausgeglichene Haushalte zu präsentieren. Also wird gespart – im Zweifelsfalle auf Kosten der Kommunen. Das ist sehr unschön für die Kommunen dieses Landes aber denn doch von eben dieser CDU, für die Frau Stupp antritt, im Grundsatz so gewollt.
Und der SPD-Kandidat? Wer von der SPD erwartet hätte, dass hier eine Gegenposition bezogen würde, der sah sich getäuscht (… wobei, wer in Frechen glaubt an eine sozialdemokratische Gegenposition?). Ferdi Huck hat das neoliberale Denken so verinnerlicht, dass er die CDU sogar beim Thema Personaleinsparung gerne überholen will. Es gäbe in der städtischen Verwaltung noch größere Einsparpotentiale, die es zu heben gelte und die er heben werde. Alles, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und um Steuererhöhungen zu vermeiden.
Das ist für Außenstehende nun nicht wirklich zu beurteilen, dass nun aber der SPD-Kandidat den Sparkommissar gibt, seine CDU-Gegnerin dagegen erklärt, für sie sähe es so aus, als sei die Grenze der Personaleinsparungen erreicht, das erstaunt denn doch gewaltig.
Erstaunlich aber bleibt allemal, dass die SPD vom Kopf bis zu den Füssen, von Gabriel bis Huck, sich dem neoliberalen Denken verschrieben hat und nicht erkennt, dass eben diese Alternativlosigkeit des Handelns, die sich hieraus ergibt, der CDU in die Hände spielt. Wer braucht eine SPD, wenn sie sich von der CDU nicht unterscheidet?
Politische Binsenweisheiten stimmen so lange, bis sie nicht mehr stimmen. Eine davon ist, dass linke Parteien nur aus der Mitte heraus Wahlen gewinnen. (…)Doch diese Binse funktioniert nicht immer und überall. Wir sehen das an dem stetigen Niedergang der SPD, die noch nie konservativer war als unter ihrem jetzigen Parteichef Sigmar Gabriel.Nun ist das nicht Gabriels Schuld alleine. Die SPD ist insgesamt nach rechts gerückt. Das hat sicherlich eine längere Vorgeschichte, die mit Schröders Agenda 2010 und die wirtschaftsfreundlichen Gesetze der damaligen rotgrünen Koalition einen ersten Höhepunkt erlebte. Die große Koalition, die die SPD gerne eingegangen ist, stellt da vermutlich nur den letzten Sargnagel dar.
Der Grund ist der gleiche wie der bei der SPD. Der kardinale politische Fehler der Sozialdemokraten und anderer linker Parteien in Europa ist die Akzeptanz einer neoliberalen Wirtschaftsdoktrin. Ich will an dieser Stelle nicht inhaltliche Argumente für oder gegen diese Doktrin diskutieren. Mir geht es hier um die neoliberale Politik, die zu einem Verfall der Reallöhne beigetragen hat. Sie führte zu Machtverschiebungen in der Wirtschaft zuungunsten von Gewerkschaften und zugunsten von Banken.
Das Grundproblem aller Sozialdemokraten ist die tiefe Verankerung der neoliberalen Doktrin in der europäischen Politik und in den europäischen Verträgen - im Maastrichter Vertrag, im Stabilitätspakt und seinen späteren Varianten und zuletzt im Fiskalpakt. Diese von Konservativen verfassten Regeln reduzieren die politischen Spielräume. Und damit sind Sozialdemokraten aus Sicht der Wähler von Christdemokraten nicht mehr zu unterscheiden.Das klingt nun so, als finde die neoliberale Politik nur auf der nationalen bzw. der europäischen Ebene statt. Dem ist aber nicht so. Die Konservativen haben, und die SPD ist diesen Weg mitgegangen, in die verschiedenen Verfassungen die Generalregel des ausgeglichenen Haushalts bis 2020 hineingeschrieben. Wenn ein Bundesland bereits mit einem ordentlichen Packen an Schulden belastet ist, so bedeutet der Zwang zum ausgeglichenen Haushalt, dass auf Jahre hinaus scharf gespart werden muss. Und das bricht sich runter bis auf die einzelne Kommune.
Gestern bei der Podiumsdebatte der Frechener Bürgermeisterkandidaten wurde man Zeuge zu welchen Schizophrenien die tiefe Verankerung neoliberalen Denkens in der Kommunalpolitik führen kann.
So sang die CDU-Kandidatin Frau Stupp, als es um die Frage der Kommunalfinanzen ging, ein Hohelied auf das Königsrecht eines jeden Kommunalparlaments, also das Recht, einen eigenen Haushalt verabschieden zu dürfen. Einfach formuliert verlieren Kommunen dieses Recht, wenn sie keinen ausgeglichenen Haushalt präsentieren können: sie kommen unter staatliche Kuratel. Frau Stupp will nicht, dass Frechen unter staatliche Kuratel kommt. Also will sie weiterhin ausgeglichene Haushalte präsentieren. Das aber ist schwierig, denn Kommunen müssen viele Aufgaben erledigen, die ihnen vom Land oder vom Bund zugewiesen werden. (bspw. im sozialen Bereich). Leider vergessen Bund und Land aber, den Kommunen hierfür ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.
Alles richtig und doch alles falsch, denn Bund und Länder sind laut den von den Konservativen gewollten Verfassungsänderungen gezwungen, ausgeglichene Haushalte zu präsentieren. Also wird gespart – im Zweifelsfalle auf Kosten der Kommunen. Das ist sehr unschön für die Kommunen dieses Landes aber denn doch von eben dieser CDU, für die Frau Stupp antritt, im Grundsatz so gewollt.
Und der SPD-Kandidat? Wer von der SPD erwartet hätte, dass hier eine Gegenposition bezogen würde, der sah sich getäuscht (… wobei, wer in Frechen glaubt an eine sozialdemokratische Gegenposition?). Ferdi Huck hat das neoliberale Denken so verinnerlicht, dass er die CDU sogar beim Thema Personaleinsparung gerne überholen will. Es gäbe in der städtischen Verwaltung noch größere Einsparpotentiale, die es zu heben gelte und die er heben werde. Alles, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und um Steuererhöhungen zu vermeiden.
Das ist für Außenstehende nun nicht wirklich zu beurteilen, dass nun aber der SPD-Kandidat den Sparkommissar gibt, seine CDU-Gegnerin dagegen erklärt, für sie sähe es so aus, als sei die Grenze der Personaleinsparungen erreicht, das erstaunt denn doch gewaltig.
Erstaunlich aber bleibt allemal, dass die SPD vom Kopf bis zu den Füssen, von Gabriel bis Huck, sich dem neoliberalen Denken verschrieben hat und nicht erkennt, dass eben diese Alternativlosigkeit des Handelns, die sich hieraus ergibt, der CDU in die Hände spielt. Wer braucht eine SPD, wenn sie sich von der CDU nicht unterscheidet?
Thema: Buergermeisterwahl 2015
07. September 15 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
Die Bertelsmann-Stiftung hat eine Analyse der Bremer Bürgerschaftswahlen 2015 unter dem Titel „prekäre Wahlen“ veröffentlicht.
Dabei wurde untersucht, wie sich Wahlbeteiligung und Wahlverhalten entwickelt haben, insbesondere ob die Wahlen als repräsentativ betrachtet werden können.
Die Zusammenfassung ist mehr als ernüchtern:
Hier im Blog wurden solche Ergebnisse bereits zwei Mal an den Frechener Wahlergebnisse gespiegelt: Schwarzer Gürtel und Kein Erfolg in Sicht
Um uns nicht zu wiederholen wurde nun der Blickwinkel etwas verschoben mit dem Ziel die Bürgermeisterwahlen von 1999 mit denen des Jahres 2009 zu vergleichen. Geprüft wurde, in welchen Wahlbezirken der SPD-Kandidat des Jahres 2009 im Vergleich mit dem Jahr 1999 am schwächsten abgeschnitten hatte.
Man könnte diese Wahlbezirke auch als Ferdis Problembezirke bezeichnen.
Überraschenderweise konzentrieren sich diese Problembezirke nicht auf Königsdorf und Bachem, womit irgendwie zu rechnen war. Hier liegt nur einer der insgesamt 9 analysierten Bezirke (WB 1: Johannesschule). Ebenfalls hochproblematisch sind die WB 21 und 22 (Grefrath und Habbelrath), die Bachemer Wahlbezirke 18 und 20 (Haus Burggraben und CJD) sowie die innerstädtischen Wahlbezirke 7, 8, 15 und 16 (Gymnasium, Heinrich-Böll-Schule, Burgschule und Herbertskaul).
Bei der Analyse wurden die innerstädtischen Wahlkreise und die Wahlkreise des „schwarzen Gürtels“ (Königsdorf, Buschbell, Bachem, Habbelrath und Grefrath) getrennt betrachtet.
Schauen wir im ersten Schritt auf die Wahlbezirke des "schwarzen Gürtels".
Gegenüber 1999 haben die Wahlbezirke des „schwarzen Gürtels“ 1.363 Wahlberechtigte durch Zuzug in den Neubaugebieten gewonnen. Trotzdem sind 2009 nur 63 Wahlberechtigte mehr zu Wahl gegangen als 1999. Die Wahlbeteiligung sank somit um rund 9,9% (von 66% auf 56,1%). Die Auswirkungen jedoch fielen für SPD und CDU ganz unterschiedlich aus. Die SPD verlor real 618 Stimmen oder 12,5% (von 41,8% auf 29,3%) der abgegebenen Stimmen, die CDU dagegen „vermisste“ nur 91 Stimmen oder 2% der abgegebenen Stimmen (von 53,9% auf 51,9%).
Wirklich repräsentativ waren die Wahlen in beiden Fällen nicht. Bezogen auf die Anzahl aller Wahlberechtigten erreichte die CDU 1999 35,6% und 2009 noch 29,2%. Die SPD erreichte 1999 immerhin 27,6% und 2009 gerade mal 16,5% aller Wahlberechtigten.
In den innerstädtischen Wahlbezirken stellen sich die Verhältnisse für die SPD im Grunde noch ungünstiger dar. Auch hier hat die Anzahl der Wahlberechtigten zwischen 1999 und 2009 zugenommen und zwar um 640 WählerInnen. Die Anzahl der abgegebenen Stimmen sank im gleichen Zeitraum trotzdem um 484 Stimmen. Bezogen auf die Wahlbeteiligung bedeutet das einen Rückgang 11,9% von 58,9% auf noch 47%.1999 lag die Wahlbeteiligung hier bereits um 7% niedriger als in den Wahlbezirken des "schwarzen Gürtels". Der Abstand war nun auf 9% gestiegen.
Gegenüber 1999 verlor die CDU 476 Stimmen, was 6% der abgegebenen Stimmen entsprach (von 52,3% auf 46,3%), die SPD aber 579 oder 10,4%. Der Stimmenanteil der SPD sank damit von 43,7% auf 33,3%.
Auch hier kann natürlich von einer wirklichen Repräsentativität des Ergebnisses keine Rede sein: die CDU erreichte 1999 30,8% aller Wahlberechtigten und 2009 noch 21,7%, bei der SPD sehen wir einen Rückgang von 25,8% auf 15,6%.
Entscheidend aber ist: addiert man beide Gruppen von Wahlbezirken, so sind hier rund 40% aller Wahlberechtigten beheimatet. Die SPD hat in ihren als „Problembezirke“ bezeichneten Wahlbezirken zwischen 1999 und 2009 spürbar höhere Stimmverluste als die CDU erlitten. Und dies obwohl der CDU-Kandidat bei der Bürgermeisterwahl von 2009 stadtweit 9,9% der Stimmen verloren hatte, der SPD-Kandidat dagegen "nur" 6,8%. In den „SPD-Problembezirken“ verlor die CDU hingegen "minimale" 3,6% der Stimmen, die SPD dafür 11,2%, prozentual also das Dreifache.
In diesen Zahlen ist erkennbar, dass Elemente, die durch die Bertelsmann-Stiftung herausgearbeitet wurden und die negative Effekte auf Wahlbeteiligung und Repräsentativität einer Wahl haben, auch in Frechen auffindbar sind.
Je prekärer die Lebensverhältnisse, desto geringer die Wahlbeteiligung, so die zentrale These. Dies wirkt sich, da Parteien ein je unterschiedliches Wählerklientel ansprechen, unterschiedlich auf die Wahlchancen der Parteien aus.
Hier in Frechen kann gelten, dass die „besseren“ Stadtteile einen immer größeren Einfluss auf die Repräsentativkörperschaften ausüben können. Durch eine nachweislich deutlich höhere Wahlbeteiligung verändert sich die Sitzverteilung im Rat oder, wie aktuell, die Besetzung des Bürgermeisterpostens zu Gunsten des Wahlverhaltens dieser Stadtteile.
Erschwerend kommt hinzu, dass die SPD und deren Bürgermeisterkandidat 2009 keinen Weg gefunden hatten, der steigenden Wahlenthaltung bei der eigenen Klientel entgegen zu wirken. Nachdem der Kandidat von 2009 derselbe ist wie 2015 scheint sich an diesem Grundzug des Wahlkampfes des SPD-Kandidaten nichts geändert zu haben. Es steht also zu befürchten, dass bei der Bürgermeisterwahl am 13. September die Wahlbeteiligung noch weiter zurückgeht und sich das vorrangig in den sozial schlechter positionierten Wahlbezirken abspielen wird, die früher als SPD-Wahlbezirke beschrieben werden konnten.
Der SPD-Kandidat wird diese Wahl nicht deshalb verlieren, weil die CDU-Kandidatin viel besser wäre, nein er wird die Wahl verlieren, da sein Wahlkampf in seiner erkennbaren Inhaltsarmut die ursprüngliche SPD-Wählerklientel nicht anspricht.
Wenn man es auf eine Frage zuspitzt, so könnte sie lauten:
Welches politische Angebot macht der SPD-Kandidat einem in der Burgstraße lebenden Geringverdiener, der auf staatliche Transferleistungen angewiesen ist?
Warum sollte dieser einem SPD-Kandidaten seine Stimme geben?
Dabei wurde untersucht, wie sich Wahlbeteiligung und Wahlverhalten entwickelt haben, insbesondere ob die Wahlen als repräsentativ betrachtet werden können.
Die Zusammenfassung ist mehr als ernüchtern:
Mit der Wahlbeteiligung (50,1 Prozent aller Wahlberechtigten) (...) sinkt auch die rechnerische Repräsentationsquote der Bremischen Bürgerschaft: Die neu gewählte Bürgerschaft repräsentiert nur noch die Stimmen von knapp 48,6 Prozent aller wahlberechtigten Bremer Bürger.Die Studie hat keine Schlussfolgerungen über die Profiteure solcher Entwicklungen gezogen, aber es gehört keine große Phantasie dazu, um festzustellen, dass insbesondere CDU und Grüne von dieser Entwicklung begünstigt werden, denn ihr Wählerklientel rekrutieren sie in den besser gestellten Stadtteilen.
…
Die Ergebnisse unserer Studie sind eindeutig: Je prekärer die Lebensverhältnisse in einem Ortsteil, desto weniger Menschen gehen wählen. Die soziale Lage eines Ortsteils bestimmt die Höhe der Wahlbeteiligung: Je höher der Anteil von Haushalten aus den sozial schwächeren Milieus, je höher die Arbeitslosigkeit, je geringer der formale Bildungsstand und je geringer die durchschnittliche Kaufkraft der Haushalte in einem Ortsteil, desto geringer ist die Wahlbeteiligung.
…
Das hat Konsequenzen für die soziale Repräsentativität des Bremer Wahlergebnisses: Je nach sozialer Lage ihrer Stadtviertel sind die dort lebenden Menschen in der neu gewählten Bremer Bürgerschaft sehr unterschiedlich stark vertreten. Die sinkende Wahlbeteiligung ist auch in Bremen Ausdruck einer zunehmend ungleichen Wahlbeteiligung, hinter der sich eine soziale Spaltung der Wählerschaft verbirgt. Das Wahlergebnis der Bremischen Bürgerschaftswahl 2015 ist deshalb sozial nicht repräsentativ.
…
Die Bremische Bürgerschaft ist sozial gespalten und die Demokratie wird auch in Bremen zu einer immer exklusiveren Veranstaltung der Menschen aus den mittleren und oberen Sozialmilieus der Stadtgesellschaft, während die sozial schwächeren Milieus deutlich unterrepräsentiert bleiben. Die Verankerung aller Parteien in diesen Nichtwählermilieus erodiert. Deshalb wird in dieser Studie auch die Bremische Bürgerschaftswahl 2015 als eine sozial prekäre Wahl bezeichnet.
Hier im Blog wurden solche Ergebnisse bereits zwei Mal an den Frechener Wahlergebnisse gespiegelt: Schwarzer Gürtel und Kein Erfolg in Sicht
Um uns nicht zu wiederholen wurde nun der Blickwinkel etwas verschoben mit dem Ziel die Bürgermeisterwahlen von 1999 mit denen des Jahres 2009 zu vergleichen. Geprüft wurde, in welchen Wahlbezirken der SPD-Kandidat des Jahres 2009 im Vergleich mit dem Jahr 1999 am schwächsten abgeschnitten hatte.
Man könnte diese Wahlbezirke auch als Ferdis Problembezirke bezeichnen.
Überraschenderweise konzentrieren sich diese Problembezirke nicht auf Königsdorf und Bachem, womit irgendwie zu rechnen war. Hier liegt nur einer der insgesamt 9 analysierten Bezirke (WB 1: Johannesschule). Ebenfalls hochproblematisch sind die WB 21 und 22 (Grefrath und Habbelrath), die Bachemer Wahlbezirke 18 und 20 (Haus Burggraben und CJD) sowie die innerstädtischen Wahlbezirke 7, 8, 15 und 16 (Gymnasium, Heinrich-Böll-Schule, Burgschule und Herbertskaul).
Bei der Analyse wurden die innerstädtischen Wahlkreise und die Wahlkreise des „schwarzen Gürtels“ (Königsdorf, Buschbell, Bachem, Habbelrath und Grefrath) getrennt betrachtet.
Schauen wir im ersten Schritt auf die Wahlbezirke des "schwarzen Gürtels".
Gegenüber 1999 haben die Wahlbezirke des „schwarzen Gürtels“ 1.363 Wahlberechtigte durch Zuzug in den Neubaugebieten gewonnen. Trotzdem sind 2009 nur 63 Wahlberechtigte mehr zu Wahl gegangen als 1999. Die Wahlbeteiligung sank somit um rund 9,9% (von 66% auf 56,1%). Die Auswirkungen jedoch fielen für SPD und CDU ganz unterschiedlich aus. Die SPD verlor real 618 Stimmen oder 12,5% (von 41,8% auf 29,3%) der abgegebenen Stimmen, die CDU dagegen „vermisste“ nur 91 Stimmen oder 2% der abgegebenen Stimmen (von 53,9% auf 51,9%).
Wirklich repräsentativ waren die Wahlen in beiden Fällen nicht. Bezogen auf die Anzahl aller Wahlberechtigten erreichte die CDU 1999 35,6% und 2009 noch 29,2%. Die SPD erreichte 1999 immerhin 27,6% und 2009 gerade mal 16,5% aller Wahlberechtigten.
In den innerstädtischen Wahlbezirken stellen sich die Verhältnisse für die SPD im Grunde noch ungünstiger dar. Auch hier hat die Anzahl der Wahlberechtigten zwischen 1999 und 2009 zugenommen und zwar um 640 WählerInnen. Die Anzahl der abgegebenen Stimmen sank im gleichen Zeitraum trotzdem um 484 Stimmen. Bezogen auf die Wahlbeteiligung bedeutet das einen Rückgang 11,9% von 58,9% auf noch 47%.1999 lag die Wahlbeteiligung hier bereits um 7% niedriger als in den Wahlbezirken des "schwarzen Gürtels". Der Abstand war nun auf 9% gestiegen.
Gegenüber 1999 verlor die CDU 476 Stimmen, was 6% der abgegebenen Stimmen entsprach (von 52,3% auf 46,3%), die SPD aber 579 oder 10,4%. Der Stimmenanteil der SPD sank damit von 43,7% auf 33,3%.
Auch hier kann natürlich von einer wirklichen Repräsentativität des Ergebnisses keine Rede sein: die CDU erreichte 1999 30,8% aller Wahlberechtigten und 2009 noch 21,7%, bei der SPD sehen wir einen Rückgang von 25,8% auf 15,6%.
Entscheidend aber ist: addiert man beide Gruppen von Wahlbezirken, so sind hier rund 40% aller Wahlberechtigten beheimatet. Die SPD hat in ihren als „Problembezirke“ bezeichneten Wahlbezirken zwischen 1999 und 2009 spürbar höhere Stimmverluste als die CDU erlitten. Und dies obwohl der CDU-Kandidat bei der Bürgermeisterwahl von 2009 stadtweit 9,9% der Stimmen verloren hatte, der SPD-Kandidat dagegen "nur" 6,8%. In den „SPD-Problembezirken“ verlor die CDU hingegen "minimale" 3,6% der Stimmen, die SPD dafür 11,2%, prozentual also das Dreifache.
In diesen Zahlen ist erkennbar, dass Elemente, die durch die Bertelsmann-Stiftung herausgearbeitet wurden und die negative Effekte auf Wahlbeteiligung und Repräsentativität einer Wahl haben, auch in Frechen auffindbar sind.
Je prekärer die Lebensverhältnisse, desto geringer die Wahlbeteiligung, so die zentrale These. Dies wirkt sich, da Parteien ein je unterschiedliches Wählerklientel ansprechen, unterschiedlich auf die Wahlchancen der Parteien aus.
Hier in Frechen kann gelten, dass die „besseren“ Stadtteile einen immer größeren Einfluss auf die Repräsentativkörperschaften ausüben können. Durch eine nachweislich deutlich höhere Wahlbeteiligung verändert sich die Sitzverteilung im Rat oder, wie aktuell, die Besetzung des Bürgermeisterpostens zu Gunsten des Wahlverhaltens dieser Stadtteile.
Erschwerend kommt hinzu, dass die SPD und deren Bürgermeisterkandidat 2009 keinen Weg gefunden hatten, der steigenden Wahlenthaltung bei der eigenen Klientel entgegen zu wirken. Nachdem der Kandidat von 2009 derselbe ist wie 2015 scheint sich an diesem Grundzug des Wahlkampfes des SPD-Kandidaten nichts geändert zu haben. Es steht also zu befürchten, dass bei der Bürgermeisterwahl am 13. September die Wahlbeteiligung noch weiter zurückgeht und sich das vorrangig in den sozial schlechter positionierten Wahlbezirken abspielen wird, die früher als SPD-Wahlbezirke beschrieben werden konnten.
Der SPD-Kandidat wird diese Wahl nicht deshalb verlieren, weil die CDU-Kandidatin viel besser wäre, nein er wird die Wahl verlieren, da sein Wahlkampf in seiner erkennbaren Inhaltsarmut die ursprüngliche SPD-Wählerklientel nicht anspricht.
Wenn man es auf eine Frage zuspitzt, so könnte sie lauten:
Welches politische Angebot macht der SPD-Kandidat einem in der Burgstraße lebenden Geringverdiener, der auf staatliche Transferleistungen angewiesen ist?
Warum sollte dieser einem SPD-Kandidaten seine Stimme geben?
 Gegenentwürfe
Gegenentwürfe