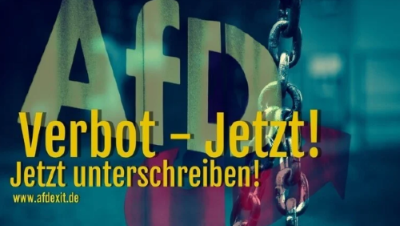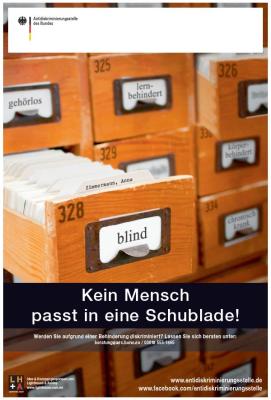Thema: Umwelt
23. Juli 14 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
An dieser Stelle eine Presseerklärung des BUND Rhein-Erft
Der Buschbeller Wald ist ein alter und ungewöhnlich naturnaher Laubwald im Rhein-Erft-Kreis. Er hat dem Frechener Ortsteil Buschbell seinen Namen gegeben. Jahrhunderte lang war er Mensch, Tier und Pflanze eine Heimat. Heute wird er durch den fortschreitenden Tagebau der Quarzwerke -Gruppe langsam aber stetig gerodet und abgebaggert. Er hätte nach den Meldekriterien der Europäischen Gemeinschaft unbedingt als FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Gebiet gemeldet werden müssen. Dies ist jedoch aus wirtschaftlichen Gründen unterlassen worden. Bei der Prüfung der „Umweltverträglichkeit“ seiner Vernichtung sind dann viele europäisch geschützte Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumtypen nicht berücksichtigt worden. Mindestens acht Fledermausarten nutzen den Wald. Er ist Lebensraum von Schwarz- und Mittelspecht, Waldohreule, Waldkauz, Uhu, Feuersalamander, Springfrosch, sowie einer Vielzahl weiterer streng geschützter Tier- und Pflanzenarten. Allen diesen ist gemeinsam, dass die auf Altwälder angewiesen sind. Damit ist er eine „Arche Noah“ für diese Arten im waldärmsten Kreis von NRW. Trotz der Evidenz von beispielsweise Fledermausvorkommen hat das Unternehmen ohne die rechtlich gebotenen Ausgleichsmaßnahmen für den Artenschutz jahrelang den wertvollen Altwald gerodet. Zudem wurden im vergangenem Jahr noch während der Schonzeit Bäume gefällt.
Wer mehr wissen will:
Buschbeller Wald
Zur Unterschriftensammlung
Der Buschbeller Wald ist ein alter und ungewöhnlich naturnaher Laubwald im Rhein-Erft-Kreis. Er hat dem Frechener Ortsteil Buschbell seinen Namen gegeben. Jahrhunderte lang war er Mensch, Tier und Pflanze eine Heimat. Heute wird er durch den fortschreitenden Tagebau der Quarzwerke -Gruppe langsam aber stetig gerodet und abgebaggert. Er hätte nach den Meldekriterien der Europäischen Gemeinschaft unbedingt als FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Gebiet gemeldet werden müssen. Dies ist jedoch aus wirtschaftlichen Gründen unterlassen worden. Bei der Prüfung der „Umweltverträglichkeit“ seiner Vernichtung sind dann viele europäisch geschützte Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraumtypen nicht berücksichtigt worden. Mindestens acht Fledermausarten nutzen den Wald. Er ist Lebensraum von Schwarz- und Mittelspecht, Waldohreule, Waldkauz, Uhu, Feuersalamander, Springfrosch, sowie einer Vielzahl weiterer streng geschützter Tier- und Pflanzenarten. Allen diesen ist gemeinsam, dass die auf Altwälder angewiesen sind. Damit ist er eine „Arche Noah“ für diese Arten im waldärmsten Kreis von NRW. Trotz der Evidenz von beispielsweise Fledermausvorkommen hat das Unternehmen ohne die rechtlich gebotenen Ausgleichsmaßnahmen für den Artenschutz jahrelang den wertvollen Altwald gerodet. Zudem wurden im vergangenem Jahr noch während der Schonzeit Bäume gefällt.
Wer mehr wissen will:
Buschbeller Wald
Zur Unterschriftensammlung
Thema: Gesamtschule
23. Juli 14 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
NIcht dass wir die Berichterstattung vernachlässigen würden.
Die Erftstädter Elternbefragung hat ein eindeutiges Ergebnis erbracht.
Eltern wollen Gesamtschule, so betitelte die Rundschau ihren Artikel. Und nun wird bereits über den Standort diskutiert. Mitten in den Ferien ....
Undenkbar in Frechen, oder ist der neue Rat der Stadt beweglicher als der alte?
Die Erftstädter Elternbefragung hat ein eindeutiges Ergebnis erbracht.
Eltern wollen Gesamtschule, so betitelte die Rundschau ihren Artikel. Und nun wird bereits über den Standort diskutiert. Mitten in den Ferien ....
Undenkbar in Frechen, oder ist der neue Rat der Stadt beweglicher als der alte?
Thema: Inklusion
04. Juli 14 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
Die Gemeinschaftsgrundschule in Wolperath im Rhein-Siegkreis hat in diesem Jahr den Jakob Muth-Preis für vorbildliches inklusives Lernen ausgezeichnet worde.
Aus dem hier verlinkten Artikel habe ich einige Aussagen herausgezogen, die einzelne Aspekte der derzeitigen Inklusionsdiskussion in ein anderes Licht rücken könnten:
Aus dem hier verlinkten Artikel habe ich einige Aussagen herausgezogen, die einzelne Aspekte der derzeitigen Inklusionsdiskussion in ein anderes Licht rücken könnten:
Denn ob der gemeinsame Unterricht überhaupt unter den jetzigen Bedingungen in Nordrhein-Westfalen sinnvoll ist, ist umstritten. Die Grundschule in Wolperath ist der beste Beweis, dass das klappen kann – und sogar sehr gut. Elisabeth Schmies betont, dass ihre Schule keine Sonderbehandlung bekommt. „Wir haben dieselben Rahmenbedingungen wie alle anderen auch.“
In der derzeitigen Debatte über Inklusion werde immer wieder lautstark nach Ressourcen gerufen. Mehr Lehrer, mehr Platz, mehr Geld. „Sicher braucht man für das gemeinsame Lernen auch Ressourcen. Aber ich glaube, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist das Wollen. Der feste Glaube daran, dass es geht. (…) Wenn ich immer nach dem Optimalen suche, werde ich nie zufrieden sein.“
Das alles ist nur deswegen möglich, weil das Kollegium sich verpflichtet hat, jeden Tag bis 16 Uhr in der Schule anwesend zu sein. „Ungewöhnlich“, gibt Schmies zu, „aber in meinen Augen unverzichtbar. Sonst könnten wir die Fülle der Aufgaben, die die Inklusion mit sich bringt, nicht stemmen. Denn das geht nur im Team, kein Lehrer kann das alleine.“ Für sie ist die gängige Arbeitsorganisation an Schulen „ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert und den heutigen Aufgabenstellungen überhaupt nicht mehr angemessen.“
Natürlich gebe es immer wieder Herausforderungen, auch mit schwierigen Kindern. Aber am Ende sei das eine Frage der Haltung: „Frage nicht: Wie schaffen wir es, dass das Kind sich anpasst? Sondern: Wie können wir das System anpassen?“Da könnte sich so manche Schule und die dort tätigen LehrerInnen noch die eine oder andere Scheibe abschneiden.
Thema: Umwelt
30. Juni 14 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
Die dänische Stadtdesignerin Helle Søholt über Stadtplanung und und Mobilität in der Stadt.
Helle Søholts Referenz ist die Stadt Kopenhagen, mit einem Radverkehrsanteil von rund 50%.
ZEIT ONLINE: In Deutschland zögern viele Bürgermeister vor allem kleinerer Städte, in Radwege zu investieren. Sie sehen die enormen Kosten und behaupten, sie gewönnen dadurch nichts. Was sagen Sie diesen Bürgermeistern?
Helle Søholt:: Radfahrer machen eine Stadt erst richtig lebendig. Man sieht Gesichter auf der Straße, und nicht nur hinter Windschutzscheiben. Die Stadt wird als menschenfreundlich wahrgenommen und dadurch attraktiv. Sie zieht Familien an, aber auch Unternehmen und gut ausgebil-dete Talente, die in der Stadt leben wollen.
ZEIT ONLINE: Was könnten sich Kommunen von Kopenhagen abschauen – einfache Dinge, deren Umsetzung kein Vermögen kostet?
Helle Søholt:: Die Stadtverwaltung hat über einen Zeitraum von 20 Jahren öffentlichen Parkraum umgewandelt in Plätze für Cafés und Spielplätze sowie Raum für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Das geschah langsam, pro Jahr nahm die Stadt zwei bis drei Prozent Parkfläche weg. Zeitgleich hat sie die Gebühren für die noch bestehenden Parkplätze erhöht. So wurde erreicht, dass Menschen, die bisher mit dem Auto in die Stadt gefahren sind, aufs Rad umgestiegen sind.
(…)
ZEIT ONLINE: In Deutschland sagen Kritiker, es sei für Radfahrer sicherer, wenn sie auf der Straße zusammen mit den Autos fahren. In Kopenhagen sieht man das offensichtlich anders: Zumindest in der Innenstadt beherrschen separate Radwege das Straßenbild...
Helle Søholt:: ... und zwar nicht einfach nur auf die Straße gemalte Spuren, sondern echte separate Wege, die von der Autospur durch einen Bordstein getrennt sind und wiederum durch einen Bordstein vom Gehweg. Das macht einen gewaltigen Unterschied, denn es erhöht die gefühlte Sicherheit.
ZEIT ONLINE: Wie wichtig ist die gefühlte Sicherheit?
Helle Søholt:: Enorm wichtig. Ist das Gefühl von Sicherheit groß, dann haben Eltern genug Vertrauen, mit ihrem Kind Rad zu fahren, und Ältere trauen sich aufs Rad. Wenn es Ihnen nur um junge Männer geht, die stark genug sind, den Kampf mit den Autofahrern aufzunehmen, dann können Sie die auf der Straße fahren lassen. Wollen Sie aber das Fahrrad zu einem attraktiven Transportmittel für die Allgemeinheit machen, dann müssen Sie eine getrennte Infrastruktur schaffen.
ZEIT ONLINE: Kopenhagens Philosophie ist: Bietet man eine gute Infrastruktur an, werden die Leute sie auch benutzen. Spürt die Stadt schon den Fluch des Erfolgs?
Helle Søholt:: Im Zentrum liegt der Radverkehrsanteil bei etwa 50 Prozent, im gesamten Stadtgebiet sind es 35 Prozent. Zum Vergleich: In den meisten anderen Städten in Europa machen Radfahrer 15 bis höchstens 20 Prozent des gesamten Verkehrs aus. Insofern ist der Radverkehr in Kopenhagen schon dominant. Wo die obere Grenze liegt, ist schwer zu sagen. Aber in der Tat kommt es inzwischen zu Staus auf Radwegen.
ZEIT ONLINE: Wie reagiert die Stadtverwaltung darauf?
Helle Søholt:: Sie beginnt, auf Schlüsselstrecken die Wege zu verbreitern, also dem Autoverkehr weiteren Raum wegzunehmen. Es wird versucht, Radwege in zwei Spuren zu teilen, so dass schnellere Radler langsamere überholen können. Und die Stadt experimentiert damit, ganze Straßen für Autos zu sperren und dort nur noch Radfahrer, öffentlichen Nahverkehr und eventuell noch Anlieger zuzulassen. Die Stadtverwaltung ist sehr innovativ und stets bereit, neue Ideen auszuprobieren. Es überrascht mich ein wenig, dass Deutschland in diesem Punkt nicht weiter ist.
(...) Es ist erstaunlich, dass die Deutschen beim Radverkehr hinterherhinken.
ZEIT ONLINE: Das könnte an der starken Autolobby liegen...
Helle Søholt:: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Deutschland hat eine große Autotradition und eine starke Industrie. Deshalb herrscht wohl eine gewisse Zurückhaltung, den Autoverkehr zu beschränken. Aber heutzutage kommt der wirtschaftliche Antrieb eines Landes aus den Städten. Und die werden sicherlich nicht dadurch attraktiver, dass man sie möglichst autofreundlich macht. Ich habe niemals jemanden getroffen, der eine Stadt dafür gelobt hätte, dass sie so effizient auf das Auto ausgerichtet ist. Das ist für die meisten kein entscheidendes Kriterium. In den Städten wollen wir Leben, Kultur, Sicherheit, Nähe, Inspiration – der schnellste Weg zur Autobahn hat nicht die höchste Priorität.
(...)
ZEIT ONLINE: In Deutschland zögern viele Bürgermeister vor allem kleinerer Städte, in Radwege zu investieren. Sie sehen die enormen Kosten und behaupten, sie gewönnen dadurch nichts. Was sagen Sie diesen Bürgermeistern?
Helle Søholt:: Radfahrer machen eine Stadt erst richtig lebendig. Man sieht Gesichter auf der Straße, und nicht nur hinter Windschutzscheiben. Die Stadt wird als menschenfreundlich wahrgenommen und dadurch attraktiv. Sie zieht Familien an, aber auch Unternehmen und gut ausgebil-dete Talente, die in der Stadt leben wollen.
ZEIT ONLINE: Was könnten sich Kommunen von Kopenhagen abschauen – einfache Dinge, deren Umsetzung kein Vermögen kostet?
Helle Søholt:: Die Stadtverwaltung hat über einen Zeitraum von 20 Jahren öffentlichen Parkraum umgewandelt in Plätze für Cafés und Spielplätze sowie Raum für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Das geschah langsam, pro Jahr nahm die Stadt zwei bis drei Prozent Parkfläche weg. Zeitgleich hat sie die Gebühren für die noch bestehenden Parkplätze erhöht. So wurde erreicht, dass Menschen, die bisher mit dem Auto in die Stadt gefahren sind, aufs Rad umgestiegen sind.
(…)
ZEIT ONLINE: In Deutschland sagen Kritiker, es sei für Radfahrer sicherer, wenn sie auf der Straße zusammen mit den Autos fahren. In Kopenhagen sieht man das offensichtlich anders: Zumindest in der Innenstadt beherrschen separate Radwege das Straßenbild...
Helle Søholt:: ... und zwar nicht einfach nur auf die Straße gemalte Spuren, sondern echte separate Wege, die von der Autospur durch einen Bordstein getrennt sind und wiederum durch einen Bordstein vom Gehweg. Das macht einen gewaltigen Unterschied, denn es erhöht die gefühlte Sicherheit.
ZEIT ONLINE: Wie wichtig ist die gefühlte Sicherheit?
Helle Søholt:: Enorm wichtig. Ist das Gefühl von Sicherheit groß, dann haben Eltern genug Vertrauen, mit ihrem Kind Rad zu fahren, und Ältere trauen sich aufs Rad. Wenn es Ihnen nur um junge Männer geht, die stark genug sind, den Kampf mit den Autofahrern aufzunehmen, dann können Sie die auf der Straße fahren lassen. Wollen Sie aber das Fahrrad zu einem attraktiven Transportmittel für die Allgemeinheit machen, dann müssen Sie eine getrennte Infrastruktur schaffen.
ZEIT ONLINE: Kopenhagens Philosophie ist: Bietet man eine gute Infrastruktur an, werden die Leute sie auch benutzen. Spürt die Stadt schon den Fluch des Erfolgs?
Helle Søholt:: Im Zentrum liegt der Radverkehrsanteil bei etwa 50 Prozent, im gesamten Stadtgebiet sind es 35 Prozent. Zum Vergleich: In den meisten anderen Städten in Europa machen Radfahrer 15 bis höchstens 20 Prozent des gesamten Verkehrs aus. Insofern ist der Radverkehr in Kopenhagen schon dominant. Wo die obere Grenze liegt, ist schwer zu sagen. Aber in der Tat kommt es inzwischen zu Staus auf Radwegen.
ZEIT ONLINE: Wie reagiert die Stadtverwaltung darauf?
Helle Søholt:: Sie beginnt, auf Schlüsselstrecken die Wege zu verbreitern, also dem Autoverkehr weiteren Raum wegzunehmen. Es wird versucht, Radwege in zwei Spuren zu teilen, so dass schnellere Radler langsamere überholen können. Und die Stadt experimentiert damit, ganze Straßen für Autos zu sperren und dort nur noch Radfahrer, öffentlichen Nahverkehr und eventuell noch Anlieger zuzulassen. Die Stadtverwaltung ist sehr innovativ und stets bereit, neue Ideen auszuprobieren. Es überrascht mich ein wenig, dass Deutschland in diesem Punkt nicht weiter ist.
(...) Es ist erstaunlich, dass die Deutschen beim Radverkehr hinterherhinken.
ZEIT ONLINE: Das könnte an der starken Autolobby liegen...
Helle Søholt:: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Deutschland hat eine große Autotradition und eine starke Industrie. Deshalb herrscht wohl eine gewisse Zurückhaltung, den Autoverkehr zu beschränken. Aber heutzutage kommt der wirtschaftliche Antrieb eines Landes aus den Städten. Und die werden sicherlich nicht dadurch attraktiver, dass man sie möglichst autofreundlich macht. Ich habe niemals jemanden getroffen, der eine Stadt dafür gelobt hätte, dass sie so effizient auf das Auto ausgerichtet ist. Das ist für die meisten kein entscheidendes Kriterium. In den Städten wollen wir Leben, Kultur, Sicherheit, Nähe, Inspiration – der schnellste Weg zur Autobahn hat nicht die höchste Priorität.
(...)
 Gegenentwürfe
Gegenentwürfe