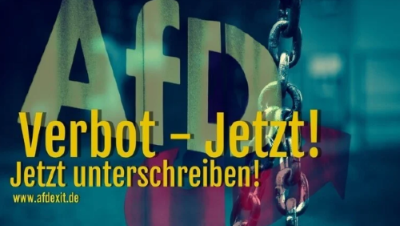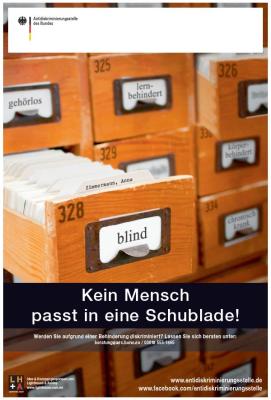Thema: Landtagswahl 2012
11. Mai 12 | Autor: antoine favier | 1 Kommentar | Kommentieren
Aktuell gibt es eine Falkenkampagne in NRW: „Stein im Brett“ mit der die Falken auf kinder- und jugendpolitische Themen aufmerksam machen wollen und dazu auch die Haltung der WahlkreiskandidatInnen abgefragt haben. Die Falken des Rheinerftkreises waren in den vergangenen Tagen mit dieser Aktion bei den DirektkandidatInnen unterwegs und haben ihre Ergebnisse nun veröffentlicht.
Zu folgenden Themen haben die Falken die KandidatInnen befragt:
Kinder und Jugendliche brauchen Bildung! Dabei ist Bildung mehr als Schule!
Kinder und Jugendliche brauchen Rechte – Die UN-Kinderrechtekonvention endlich ernst nehmen!
Kinder und Jugendliche brauchen Perspektiven, Sicherheit und langfristige Chancen.
Zivilgesellschaft braucht Engagement – Ehrenamtliches Engagement braucht Förderung.
Demokratie braucht Vielfalt, Menschenrechte und Solidarität.
Die Antworten waren, drücken wir es mal so aus: Auch Nichtkommunikation ist Kommunikation.
Von den drei DirektkandidatInnen der FDP meldeten sich zwei auf die Mailanfrage zurück, Herr Schiller aus dem Frechener Wahlkreis ließ dann aber einen bereits vereinbarten Termin ohne Rückmeldung ausfallen – einfach ungehörig!
Die drei DirektkandidatInnen der CDU wollen mit den Falken nichts zu tun haben. Zwei haben auf die Mailanfrage nicht reagiert und die Direktkandidatin im Frechener Wahlkreis, Frau Klöpper erklärte am Wahlkampfstand:“ „Von uns braucht Ihr Falken nie eine Antwort erwarten!“ Etwas mehr Stil hätte ich mir schon erwartet – aber stilvolles Untergehen lernt man halt nur auf der „Titanic“.
Wer politisches Engagement der Jugend einfordert, dabei jedoch solche Reaktionen zeigt, der ist, mal ehrlich, weder für die Eltern von Jugendlichen wählbar noch für die Jugendlichen selber.
Die übrigen befragten DirektkandidatInnen von SPD, Grünen, Linken und Piraten unterstüzen grosso modo die Forderungen der Falken. Guido van den Berg kennt sogar den Falkengruß, vermutlich war er selber mal einer. Frau D’Moch-Schweren für die SPD im Frechener Wahlkreis und Herr Schuhmacher ebendort für die Grünen betonten beide die Bedeutung der Umsetzung der Kinderrechtskonvention, soll heißen: der Inklusion behinderter Kinder im Regelschulsystem und allen übrigen gesellschaftlichen Lebensbereichen.
Jetzt hoffen wir mal, dass die Aktion der Falken noch eine breite Öffentlichkeit findet.
Zu folgenden Themen haben die Falken die KandidatInnen befragt:
Kinder und Jugendliche brauchen Bildung! Dabei ist Bildung mehr als Schule!
Kinder und Jugendliche brauchen Rechte – Die UN-Kinderrechtekonvention endlich ernst nehmen!
Kinder und Jugendliche brauchen Perspektiven, Sicherheit und langfristige Chancen.
Zivilgesellschaft braucht Engagement – Ehrenamtliches Engagement braucht Förderung.
Demokratie braucht Vielfalt, Menschenrechte und Solidarität.
Die Antworten waren, drücken wir es mal so aus: Auch Nichtkommunikation ist Kommunikation.
Von den drei DirektkandidatInnen der FDP meldeten sich zwei auf die Mailanfrage zurück, Herr Schiller aus dem Frechener Wahlkreis ließ dann aber einen bereits vereinbarten Termin ohne Rückmeldung ausfallen – einfach ungehörig!
Die drei DirektkandidatInnen der CDU wollen mit den Falken nichts zu tun haben. Zwei haben auf die Mailanfrage nicht reagiert und die Direktkandidatin im Frechener Wahlkreis, Frau Klöpper erklärte am Wahlkampfstand:“ „Von uns braucht Ihr Falken nie eine Antwort erwarten!“ Etwas mehr Stil hätte ich mir schon erwartet – aber stilvolles Untergehen lernt man halt nur auf der „Titanic“.
Wer politisches Engagement der Jugend einfordert, dabei jedoch solche Reaktionen zeigt, der ist, mal ehrlich, weder für die Eltern von Jugendlichen wählbar noch für die Jugendlichen selber.
Die übrigen befragten DirektkandidatInnen von SPD, Grünen, Linken und Piraten unterstüzen grosso modo die Forderungen der Falken. Guido van den Berg kennt sogar den Falkengruß, vermutlich war er selber mal einer. Frau D’Moch-Schweren für die SPD im Frechener Wahlkreis und Herr Schuhmacher ebendort für die Grünen betonten beide die Bedeutung der Umsetzung der Kinderrechtskonvention, soll heißen: der Inklusion behinderter Kinder im Regelschulsystem und allen übrigen gesellschaftlichen Lebensbereichen.
Jetzt hoffen wir mal, dass die Aktion der Falken noch eine breite Öffentlichkeit findet.
Thema: Landtagswahl 2012
10. Mai 12 | Autor: antoine favier | 0 Kommentare | Kommentieren
Das Prognoseinstitut election.de, das bereits 2010 die Wahlkreisergebnisse mit einer sehr hohen Treffergenauigkeit vorhergesagt hat, hat auch für diese Wahl Prognosen abgegeben.
Der Trend im Rhein-Erft-Kreis läuft gegen die bisherigen Amtsinhaber.
In einer ersten Trendmeldung vom 21.04.2012 erklärte election.de, dass die SPD einen Vorsprung in den Wahlkreisen 6 (Frechen, Kerpen, Hürth) und Wahlkreis 7 (Erftstadt, Brühl, Wesseling) habe, dagegen die CDU im Wahlkreis 5 (Pullheim, Bergheim, Bedburg) die Nase vorn. Inzwischen hat sich das Bild für die CDU verdüstert. Mit Datum vom 05.05.2012 hat election.de diese Analyse ein weiteres Mal durchgeführt. Im Wahlkreis 5 (und die „Pobleme des ehrbaren Kaufmanns Wieki“ mit Aussenständen und der Wahrheit waren zu diesem Zeitpunkt nur Eingeweihten bekannt), hat die SPD inzwischen einen Vorsprung, was auch und weiterhin im Wahlkreis 7 gilt. Der Wahlkreis 6 wird zwischenzeitlich geführt unter: „SPD wahrscheinlich“. Es sieht ganz danach aus, als müssten wir uns von der Landtagsabgeordneten Klöpper verabschieden.
Insofern bestätigt die mathematische Analyse meinen persönlichen Eindrücke, die ich am Klüttenbrunnen gewonnen habe.
Näheres hier
Der Trend im Rhein-Erft-Kreis läuft gegen die bisherigen Amtsinhaber.
In einer ersten Trendmeldung vom 21.04.2012 erklärte election.de, dass die SPD einen Vorsprung in den Wahlkreisen 6 (Frechen, Kerpen, Hürth) und Wahlkreis 7 (Erftstadt, Brühl, Wesseling) habe, dagegen die CDU im Wahlkreis 5 (Pullheim, Bergheim, Bedburg) die Nase vorn. Inzwischen hat sich das Bild für die CDU verdüstert. Mit Datum vom 05.05.2012 hat election.de diese Analyse ein weiteres Mal durchgeführt. Im Wahlkreis 5 (und die „Pobleme des ehrbaren Kaufmanns Wieki“ mit Aussenständen und der Wahrheit waren zu diesem Zeitpunkt nur Eingeweihten bekannt), hat die SPD inzwischen einen Vorsprung, was auch und weiterhin im Wahlkreis 7 gilt. Der Wahlkreis 6 wird zwischenzeitlich geführt unter: „SPD wahrscheinlich“. Es sieht ganz danach aus, als müssten wir uns von der Landtagsabgeordneten Klöpper verabschieden.
Insofern bestätigt die mathematische Analyse meinen persönlichen Eindrücke, die ich am Klüttenbrunnen gewonnen habe.
Näheres hier
Thema: Piraten
08. Mai 12 | Autor: antoine favier | 1 Kommentar | Kommentieren
"Liquid Democracy" als Mischform von direkter und repräsentative Demokratie? Einige Überlegungen
Das Modell „Liquid Democracy“ zielt darauf, dass die poltisch interessierte BürgerIn sich zu jeder anstehenden Sachfrage entscheidet:
a.) er/sie nimmt an der Entscheidung nicht teil,
b.) er/sie delegiert die Entscheidung an einen Dritten,
c.) er/sie nimmt an der Entscheidung selber teil.
Das Modell erklärt, dass die Delegierung der Stimme jederzeit wieder zurückgezogen werden kann.
Das erste Problem, das sich daraus ergibt, ist der Tatsache geschuldet, dass wir in einer hoch arbeitsteiligen Gesellschaft leben und so wie keineR mehr in der Lage ist, alle seine/ihre Bedürfnisse durch der eigenen Hände Arbeit zu befriedigen, so will und kann nicht jedeR bei allen Themen beteiligt werden. Für das Modell der „Liquid Democracy“ gar kein Problem, die Betreffenden nehmen an der Auseinandersetzung nicht teil und bleiben der Debatte und Abstimmung fern bzw. übertragen ihre Rechte auf einen Dritten.
Im Grunde legt das Modell hier bereits die Grundlagen für eine Diktatur der „Wissenden“, denn das Modell bietet sich gerade zu dafür an, dass Spezialisten (echte oder selbsternannte) das ihnen wichtige Thema monopolisieren und mittels Delegation Stimmmehrheiten für ihre Lösung kumulieren. Je abstrakter ein Thema, desto sicherer auch, dass formale Transparenz nicht ausreicht, um solche antidemokratischen Effekte zu vermeiden. Je komplexer ein Thema, je detaillierter und kleinteiliger die zu entscheidenden Maßnahmen, desto weniger Menschen werden sich an solchen Themen beteiligen. „Liquid Democracy“ legt eben nicht den Grundstein zu einer höheren Transparenz und Mitsprache, sondern schafft eine Basis für eine Diktatur der TechnokratInnen. Insbesondere der Wunsch, auch bei solchen Verfahren ein Höchstmaß an Anonymität zu ermöglichen ist die Hintertür zum zukünftigen Missbrauch des Verfahrens. Erinnert sei dabei an die Probleme des Mediums „Wikipedia“, beim dem durch eine anonymisierte Mitarbeit Artikel von Lobbyisten zugunsten von Firmen und Personen verändert wurden und werden. Zwischenzeitlich beherrschen notwendigerweise Wikipediaaufpasser das Feld und entscheiden darüber, welche Texte, welche Interpretation, ja welche Wahrheit in „Wikipedia“ veröffentlicht werden darf. Das ist in der Welt eines Lexikons womöglich angemessen, aber es zeigt bereits auf, wie anfällig dieses Formen der anonymisierten netzbasierten politischen Teilhabe sind.
Zusätzlich ist strukturell erkennbar, welch elitäres Politik- und damit Menschenmodell hier vorherrscht. Die Teilhabe am Piratenmodell erfordert ein hohes Maß an freier verfügbarer Zeit – allein dies wird innerhalb kurzer Zeit zu einer Form der verdeckten Professionalisierung und Majorisierung der Basis führen.
Der hohe Zeitbedarf grenzt aber auch alle aus, die in ihrem alltäglichen Leben aufgrund vorhandener Mehrfachbelastungen über diese Zeitreserven nicht verfügen. Insbesondere Frauen mit Kindern werden strukturell ausgegrenzt, da die internetbasierte Debattenkultur eine Schnelligkeit entwickelt hat, die jeden und jede überfordert, die eben nicht kontinuierlich am Prozess teilnehmen kann.
Die Teilhabe via Technologie grenzt aber auch all diejenigen aus, die entweder über die technischen Möglichkeiten nicht verfügen bzw. Schwierigkeiten mit ihrer Beherrschung haben.
Es grenzt all diejenigen aus, die sich am schriftlichen Diskurs nicht beteiligen können, da sie der deutschen Schriftsprache bspw. nur unzureichend mächtig sind.
Das Modell ist ein in sich Elitäres, da Zeit, technisches Knowhow und sprachliche Fähigkeiten in einem Umfang zur Grundlage der Teilhabe gemacht werden, über den Teile der heisigen Gesellschaft eben nicht verfügen.
Im Grund werden hier die Schwächen der direkten Demokratie mit den Problemen eines technischen Mediums verknüpft. Die technikaffinen Piraten jedoch suchen in erster Linie Lösungen für technische Probleme ohne zu erkennen, dass ihr Modell demokratietheoretische Defizite aufweist, die zu klären sind, bevor man sich der Technologie zuwendet.
„Unter "Liquid Democracy" versteht man eine Mischform zwischen indirekter und direkter Demokratie. Während bei indirekter Demokratie ein Delegierter zur Vertretung der eigenen Interessen bestimmt wird und bei direkter Demokratie alle Interessen selbst wahrgenommen werden müssen, ergibt sich bei Liquid Democracy ein fließender Übergang zwischen direkter und indirekter Demokratie.(Aus: Piratenwiki: Artikel Liquid Democracy)
Jeder Teilnehmer kann selbst entscheiden, wie weit er seine eigenen Interessen wahrnehmen will, oder wie weit er von Anderen vertreten werden möchte. Insbesondere kann der Delegat jederzeit sein dem Delegierten übertragenes Stimmrecht zurückfordern, und muss hierzu nicht bis zu einer neuen Wahlperiode warten. Es ergibt sich somit ein ständig im Fluss befindliches Netzwerk von Delegationen.“
Das Modell „Liquid Democracy“ zielt darauf, dass die poltisch interessierte BürgerIn sich zu jeder anstehenden Sachfrage entscheidet:
a.) er/sie nimmt an der Entscheidung nicht teil,
b.) er/sie delegiert die Entscheidung an einen Dritten,
c.) er/sie nimmt an der Entscheidung selber teil.
Das Modell erklärt, dass die Delegierung der Stimme jederzeit wieder zurückgezogen werden kann.
Das erste Problem, das sich daraus ergibt, ist der Tatsache geschuldet, dass wir in einer hoch arbeitsteiligen Gesellschaft leben und so wie keineR mehr in der Lage ist, alle seine/ihre Bedürfnisse durch der eigenen Hände Arbeit zu befriedigen, so will und kann nicht jedeR bei allen Themen beteiligt werden. Für das Modell der „Liquid Democracy“ gar kein Problem, die Betreffenden nehmen an der Auseinandersetzung nicht teil und bleiben der Debatte und Abstimmung fern bzw. übertragen ihre Rechte auf einen Dritten.
Im Grunde legt das Modell hier bereits die Grundlagen für eine Diktatur der „Wissenden“, denn das Modell bietet sich gerade zu dafür an, dass Spezialisten (echte oder selbsternannte) das ihnen wichtige Thema monopolisieren und mittels Delegation Stimmmehrheiten für ihre Lösung kumulieren. Je abstrakter ein Thema, desto sicherer auch, dass formale Transparenz nicht ausreicht, um solche antidemokratischen Effekte zu vermeiden. Je komplexer ein Thema, je detaillierter und kleinteiliger die zu entscheidenden Maßnahmen, desto weniger Menschen werden sich an solchen Themen beteiligen. „Liquid Democracy“ legt eben nicht den Grundstein zu einer höheren Transparenz und Mitsprache, sondern schafft eine Basis für eine Diktatur der TechnokratInnen. Insbesondere der Wunsch, auch bei solchen Verfahren ein Höchstmaß an Anonymität zu ermöglichen ist die Hintertür zum zukünftigen Missbrauch des Verfahrens. Erinnert sei dabei an die Probleme des Mediums „Wikipedia“, beim dem durch eine anonymisierte Mitarbeit Artikel von Lobbyisten zugunsten von Firmen und Personen verändert wurden und werden. Zwischenzeitlich beherrschen notwendigerweise Wikipediaaufpasser das Feld und entscheiden darüber, welche Texte, welche Interpretation, ja welche Wahrheit in „Wikipedia“ veröffentlicht werden darf. Das ist in der Welt eines Lexikons womöglich angemessen, aber es zeigt bereits auf, wie anfällig dieses Formen der anonymisierten netzbasierten politischen Teilhabe sind.
Zusätzlich ist strukturell erkennbar, welch elitäres Politik- und damit Menschenmodell hier vorherrscht. Die Teilhabe am Piratenmodell erfordert ein hohes Maß an freier verfügbarer Zeit – allein dies wird innerhalb kurzer Zeit zu einer Form der verdeckten Professionalisierung und Majorisierung der Basis führen.
Der hohe Zeitbedarf grenzt aber auch alle aus, die in ihrem alltäglichen Leben aufgrund vorhandener Mehrfachbelastungen über diese Zeitreserven nicht verfügen. Insbesondere Frauen mit Kindern werden strukturell ausgegrenzt, da die internetbasierte Debattenkultur eine Schnelligkeit entwickelt hat, die jeden und jede überfordert, die eben nicht kontinuierlich am Prozess teilnehmen kann.
Die Teilhabe via Technologie grenzt aber auch all diejenigen aus, die entweder über die technischen Möglichkeiten nicht verfügen bzw. Schwierigkeiten mit ihrer Beherrschung haben.
Es grenzt all diejenigen aus, die sich am schriftlichen Diskurs nicht beteiligen können, da sie der deutschen Schriftsprache bspw. nur unzureichend mächtig sind.
Das Modell ist ein in sich Elitäres, da Zeit, technisches Knowhow und sprachliche Fähigkeiten in einem Umfang zur Grundlage der Teilhabe gemacht werden, über den Teile der heisigen Gesellschaft eben nicht verfügen.
Im Grund werden hier die Schwächen der direkten Demokratie mit den Problemen eines technischen Mediums verknüpft. Die technikaffinen Piraten jedoch suchen in erster Linie Lösungen für technische Probleme ohne zu erkennen, dass ihr Modell demokratietheoretische Defizite aufweist, die zu klären sind, bevor man sich der Technologie zuwendet.
 Gegenentwürfe
Gegenentwürfe